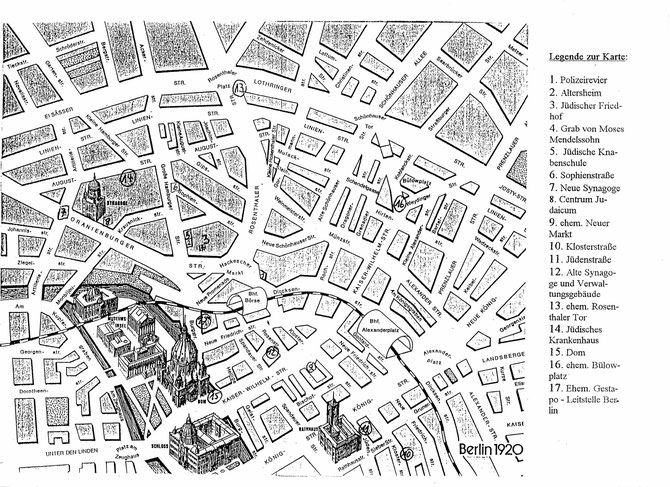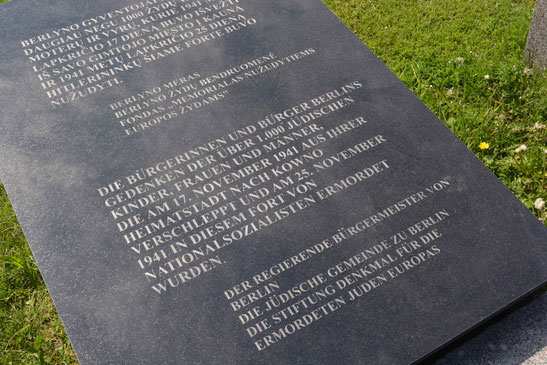Grabungsbereich Großer Jüdenhof 2013 (Abb. aus "Tagesspiegel", 29. Juli 2013, S. 8)

Die "Gerichtslaube" im Schloßpark Babelsberg

Das frühere Wohnhaus von Moses Mendelssohn in der Spandauer Straße 68 (Photo um 1900)

In der Wohnung (Spandauer Straße 68) von Moses Mendelssohn (links), Lessing (stehend, hinter dem Schachtisch), Lavater (rechts)
und Fromet Mendelssohn (in der Tür); Holzschnitt aus dem Jahre 1856 nach einem Gemälde des jüdisch-deutschen Malers Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882). Das Original-Gemälde befindet sich heute
in der Magnes-Sammlung Jüdischer Kunst in Berkeley/Kalifornien.
Das Lutherdenkmal neben der Marienkirche (Photo: Christian Meyer)

Wilhelm Krützfeld

Transportliste mit dem Namen von u.a. Alice Licht (vgl. http://www.statistik-des-holocaust.de/AT98-1.jpg)
Christian
Meyer
Spaziergang auf den Spuren der Jüdischen Mitte Berlins
Stationenfolge des Spaziergangs:
. Station 1: Jüdenstraße – Großer Jüdenhof (vgl. Karte Nr. 11)
. Station 2.: Ephraim - Palais (nicht auf der Karte abgebildet)
. Station 3.: Berliner Dom (vgl. Karte Nr. 15)
. Station 4: Spandauer Straße (vgl. südwestlich von Karte Nr. 9)
. Station 5: Ehem. Neuer Markt (vgl. Karte Nr.9)
. Station 6.: Heidereutergasse – Rosenstraße (vgl. Karte Nr. 12)
. Station 7.: Hackescher Markt (vgl. Karte Nr. 1)
. Station 8.: Ehem. Blindenwerkstatt Otto Weidt (Rosenthaler Straße 39, vgl. Karte westlich von Nr. 4 )
. Station 9.: Große Hamburger Straße („Toleranzstraße“; vgl. Karte Nr. 2-5)
. Station 10.: Neue Synagoge – Oranienburger Straße (vgl. Karte Nr. 7 & 8)
Station 1.: Jüdenstraße – Großer Jüdenhof (vgl. Karte Nr. 11)
Nahe der heutigen Jüdengasse befand sich das früheste Wohngebiet jüdischer Berliner. Vermutlich schon im 13.Jhdt. hatten sich nordöstlich des Molkenmarktes einige jüdische Familien angesiedelt.
Jüdische Kaufleute gehörten vielleicht mit zu den Stadtgründern. Die Jüdenstraße könnte mit der Anlage der Stadt um 1220/30, entstanden sein. Etwa um 1230 verliehen die Askanier das Stadtrecht.
Wahrscheinlich errichteten schon frühe jüdische Einwanderer den Großen Jüdenhof an der heutigen Grunerstraße, eine mittelalterliche Wohnanlage aus mehreren Fachwerkbauten. Vermutet wurde auch die Existenz einer Synagoge und einer Mikwe, eines Ritualbandes.
Auch nach der ersten Vertreibung der Berliner Juden blieben die Bauten (außer den Ritualbauten) und der Name erhalten und wurden von christlichen deutschen Handwerkern genutzt, umgebaut und erweitert.
Der erste Hohenzollern-Kurfürst, Friedrich I., brachte 1415 aus Nürnberg zwei jüdische Ärzte in seine neue Residenz Berlin und Cölln mit. Die Kurfürsten neigten dazu, Juden zur Ansiedlung zuzulassen. Die Landstände (Vertreter des Adels, der Geistlichkeit, des Patriziats und der Zünfte) hingegen wollten die Juden, auch aus ökonomischen Gründen, vertreiben. Der Adel hatte oft Schulden bei den jüdischen Kaufleuten und Geldverleihern, die Zünfte fürchteten die Konkurrenz der jüdischen Händler. Nur der Kurfürst hatte - als Nutznießer des Judenregals - ein echtes ökonomisches Interesse an dem Verbleib der Juden in der Mark Er konnte sie als „Kammerknechte" besteuern und oft floss ein großer Teil der Profite in den kurfürstlichen Säckel. So verlangte etwa Kurfürst Albrecht Achilles (reg.1470-1486) jährlich 1000 Gulden von den jüdischen Gemeinden Brandenburgs. Auch musste z.B. die Genehmigung für einen Rabbiner gesondert gekauft werden.
Der älteste jüdische Friedhof Berlins befand sich nahe dem heutigen Alexanderplatz. 75 Grabsteine des Friedhofs blieben nach dessen Zerstörung teilweise erhalten, da sie als Baumaterial für u.a. den Palas in der Spandauer Zitadelle zu Beginn des 16. Jhdts. benutzt wurden. Die datierten Grabsteine stammen aus den Jahren 1244 bis 1474. In der Zitadelle sind nach Restaurationsarbeiten einige dieser Grabsteine wieder sichtbar gemacht worden.
Nicht-Jüdische Handwerker pflanzten im 18. Jhdt. vor dem Haus Großer Jüdenhof 9 eine Akazie, die 1938 gefällt wurde. Reste dieses Baumes sind erhalten geblieben. Von dem Großen Jüdenhof (vgl. Abb. oben) hat ansonsten den Bombenkrieg und die Abrisse der 50er Jahre nichts überlebt. Die eingeebnete Fläche neben dem Neuen Stadthaus diente bis zum Beginn des 21. Jhdts. als Parkplatz.
Zwischen 2010 und 2012 erfolgten im Auftrage des Berliner Landesdenkmalamtes auf Teilen der Fläche archäologische Untersuchungen, die allerlei Fundamente, Keramiken etc. aus dem 17./18. Jhdt. zutage förderten, aber keine jüdischen Bewohnern zuordenbare Objekte. Ganz im Gegenteil, es fanden sich in einem ehemaligen Brunnen u.a. Schweineknochen und eine Ofenkachel, auf der Martin Luther mit Doktorhut in einem weiß-blau glasierten Triumphbogen dargestellt ist (vgl. „Tagesspiegel“, 29. Juli 2013, S. 8).
Archäologen vermuten Synagogen. und Mikwe-Reste nördlich des Ausgrabungsgebietes. Im Januar 2015 war die Ausgrabungsfläche wieder zu einem Parkplatz geworden.
Wo genau die jüdische Gemeinde im mittelalterlichen Berlin lebte, ist von daher bis heute ungewiss.
Ungefähr an der Ecke Rathausstraße/Spandauer Straße befand sich einst die „Gerichtslaube“ mit dem Pranger (vgl. Abbn. unten), die auch in der Geschichte des Jüdischen Berlin eine unselige Rolle spielte.
Station 2.: Ephraimpalais (nicht auf der Karte abgebildet)
Nach Beginn des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) beauftragte König Friedrich II. [1] den jüdischen Berliner Hofjuwelier und Münzunternehmer („Münzjuden“) Veitel Heine Ephraim (1703-1775) [2] mit der Fortführung der sächsischen Münzprägestätten im besetzten Leipzig und Dresden. Ephraim war ein Förderer der Seidenproduktion, Besitzer einer Fabrik für Gold- und Silberfäden und bedeutendster preußischer Münzunternehmer zur Zeit Friedrich II. Von 1749 bis zu seinem Tode 1775 war er der Oberlandesälteste der Berliner Judenschaft (vgl. Steiner, S. 8, a.a.O.). Sehr wahrscheinlich im Auftrage des Königs und zu Gunsten der preußischen Kriegskasse wurden dort Münzfälschungen durchgeführt. Das Besatzungsgeld hatte einen erheblichen leichteren Münzfuß und durfte deshalb auch nicht in Preußen in Umlauf gebracht werden. Die mit dem Spottnamen „Ephraimiten" (vgl. Abb. unten) belegten Münzen enthielten weit weniger Silber als vorgeschrieben. Die „Ephraimiten“ bestanden aus Kupferlegierungen, die lediglich mit einer dünnen Silberschicht belegt waren. „Außen gut, innen schlimm, außen Friedrich, innen Ephraim“, lautete ein zeitgenössischer Spottvers (mit Friedrich war der sächsische Kurfürst Friedrich August II. gemeint, dessen Porträt die Münzen zeigten). Die bewusst herbeigeführte „Münzverschlechterung“ zeigt die Ambivalenz der gesellschaftlichen Stellung reich gewordener jüdischer Unternehmer im friderizianischen Berlin: Der Ruf des Königs blieb unangetastet, während der jüdische Unternehmer das volle geschäftliche Risiko trug und gleichzeitig antijüdische Ressentiments, z. B. geschädigter kleiner Gewerbetreibender, auf sich zog.
Moses Mendelssohn verurteilte die Münzmanipulationen und lehnte eine Mitarbeit in Ephraims Bankhaus ab (vgl. Steiner, S. 15, a.a.O.).
Darüber hinaus standen Unternehmer wie Ephraim im Spannungsfeld zwischen jüdischer Tradition (Ephraim war von 1749 bis zu seinem Tode Oberlandesältester der preußischen Judenschaft und Förderer der sozialen und kulturellen Aktivitäten der Jüdischen Gemeinde Berlins) und dem Zwang zur - äußerlichen - Anpassung an die christliche Umgebungsgesellschaft. „Die Vornehmen ... gehen viel mit Christen um, nehmen gemeinschaftlich mit ihnen an unschuldigen Zerstreuungen teil, und oft sieht man es ihnen kaum an, dass sie Juden sind. Sehr viele tragen ihre Haare jetzt ebenso wie die Christen und unterscheiden sich auch in der Kleidung nicht von uns.“[3]
1762-66 ließ Ephraim durch den christlichen Architekten Friedrich Wilhelm Ditterichs (1702 – 1782; vor Einführung der Gewerbefreiheit durften Juden auch diesen Beruf nicht ausüben) ein Haus an der Ecke Poststraße und Mühlendamm umbauen. Während er privat ein Haus an der Straße Unter den Linden bewohnte und am Wilhelmplatz eine Gold- und Silbermanufaktur betrieb, wurden andere Teile der Manufaktur und das Warenlager im „Ephraim-Palais“ am Mühlendamm untergebracht. Mit seiner prachtvollen Rokoko-Fassade galt es als das schönste Privathaus Berlins.
Bei der Erweiterung des Mühlendamms im Jahr 1935 wurde das Palais abgetragen, die Fassadensteine wurden aufbewahrt, jedoch im späteren West-Berlin. Nach jahrzehntelangem Streit zwischen Ost- und West-Berliner Behörden um die Rückgabe der Steine errichtete man 1985-1987 das Ephraim-Palais unter Wiederverwendung der erhaltenen Fassadensteine in unmittelbarer Nähe des alten Standorts wieder.
Station 3.: Berliner Dom (vgl. Karte Nr. 15 )
Von 1874 bis 1890 war Adolf Stoecker (1835 -1909) Hof- und Domprediger am Berliner Dom (dem von Karl Friedrich Schinkel umgebauten Vorgängerbau des heutigen Doms). 1877 übernahm er auch die Leitung der Berliner Stadtmission. 1878 war Stoecker Mitgründer der „Christlich-Sozialen Arbeiterpartei“, die er entscheidend prägte. Neben kirchenpolitischen Zielen versuchte diese sozialkonservative Gruppierung, den wachsenden Einfluss der Sozialdemokratie auf die Arbeiterschaft zurückzudrängen. Der einflussreiche Antisemit versuchte sozusagen den Klassenkampf durch einen Rassenkampf zu ersetzen.
Nach dem völligen Scheitern dieses Versuchs (bei den Reichstagswahlen 1878 erhielten die Christlichsozialen in Berlin lediglich 1 422 Stimmen) nannte sich die bis 1918 bestehende Organisation 1881 in Christlich-Soziale Partei um. Stoecker selbst war seit 1879 als Landtags- und seit 1881 als Reichstagsabgeordneter Mitglied der deutschkonservativen Fraktionen. Er empfand sich als Begründer der antisemitischen Bewegung und setzte sich in Reden bereits um 1880 für die „Kräftigung des christlich-germanischen Geistes“ und für Gesetze gegen das „jüdische Kapital“ ein. Er bekämpfte u.a. den "jüdischen Geist' an der Börse und im Zeitungswesen. In Stoeckers antijüdischen Auslassungen spielte der Rassismus zwar noch eine untergeordnete Rolle, seine Propaganda bildete jedoch die Brücke zwischen traditionellem christlichen Antijudaismus und dem „modernen“ Antisemitismus.
Als Mitte der 1880er Jahre ein wirtschaftlicher Wiederaufschwung einsetzte, ging der Einfluss der von Stoecker initiierten antiliberalen, antisozialistischen und antisemitischen „Berliner Bewegung“ zurück. 1907 hatte die Christlichsoziale Partei reichsweit noch etwa 9 000 Mitglieder. Nach 1918 gingen ihre Reste in der neu gegründeten Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) auf.
Am Rande des Lustgartens, vor dem Dom, befindet sich seit 1981 ein von Jürgen Raue gefertigter Gedenkstein, der an Herbert Baum und die Widerstandsaktionen der Gruppe Baum erinnert.
Herbert Baum (1912 - 11. Juni 1942 in Berlin) war ein deutsch-jüdischer Widerstandskämpfer und Kommunist. Der Freundeskreis um ihn, heute oft „Gruppe Herbert Baum“ genannt, umfasste zeitweise mehr als 100 Antifaschisten, v.a. Jugendliche. Nach außen verbreiteten sie Flugblätter und unterstützen Juden, die deportiert werden sollten.
Bekannt wurde die Gruppe besonders durch ihren Brandanschlag auf die nationalsozialistische Propagandaausstellung „Das Sowjetparadies“ im Mai/Juni 1942 in Pavillons im Lustgarten. Gezeigt wurden u.a. Beutestücke aus der Sowjetunion und ein Nachbau eines angeblichen weißrussischen Dorfes. Die Ausstellung sollte den Krieg rechtfertigen und den (erschütterten) Durchhaltewillen stärken.
Der Brandanschlag vom 18. Mai hatte nur geringen Sachschaden, jedoch wurden viele Mitglieder der Gruppe Baum verhaftet, vermutlich gab es Denunzianten in der Gruppe.
1942/1943 wurden mindestens 28 Mitglieder der Gruppe hingerichtet. Herbert Baum starb im Gefängnis. Bis heute ist umstritten, ob er an den Folgen von Folter oder durch Suizid starb. Zudem wurden 50 weitere Mitglieder der Gruppe zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Schon am 17. Mai 1942 klebte eine Gruppe um Harro Schulze-Boysen („Rote Kapelle“) ca. 1000 Zettel mit der ironischen Aufschrift „Ständige Ausstellung / Das NAZI-PARADIES / Krieg Hunger Lüge Gestapo / Wie lange noch?“ in Teilen Berlins Eine Reihe von Angehörigen dieser Widerstandsgruppe bezahlten für diese Aktion mit ihrem Leben.
Der Gedenkstein im Lustgarten, der an den Anschlag der Gruppe Baum erinnert, trug 1981 folgenden Spruch:
„Unvergessen die mutigen Taten und die Standhaftigkeit der von dem Jungkommunisten Herbert Baum geleiteten antifaschistischen Widerstandsgruppe. – Für immer in Freundschaft mit der Sowjetunion verbunden.“
Dieser Text wurde im Jahre 2000 verändert, der Schlusssatz von der Freundschaft mit der Sowjetunion, wurde durch bedruckte Glasplatten mit historischen Informationen zur Gruppe Baum überdeckt. Sie schließen nun mit den Worten: „So dokumentiert dieser Gedenkstein heute die mutige Widerstandsaktion des Jahres 1942, das Geschichtsverständnis 1981 und unser andauerndes Gedenken an den Widerstand gegen das NS-Regime.“
Herbert Baum wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee (in der Ehrenreihe im Feld A1-G1beerdigt ), eine Berliner Ehrengrabstätte. Die auf das Hauptportal des Friedhofs führende Straße heißt seit 1951 Herbert-Baum-Straße.
Station 4: Spandauer Straße (vgl. Karte südwestlich von Nr. 9)
Seit 1762 wohnte bis zu seinem Tode Moses Mendelssohn (1729 - 1786) zur Miete in dem Haus Spandauer Straße 68 [4] (vergleiche Bild im Märkischen Museum).
Im Jahre 1743 war der junge Moses Mendelssohn nach Berlin gekommen; auch er musste beim Betreten Berlins den „Judenzoll" bezahlen. Darüber hinaus musste er - aus Dessau kommend - um Berlin herumlaufen, da Juden nur am Rosenthaler Tor (am heutigen Rosenthaler Platz, vgl. Karte Nr. 13) die Stadt betreten dürfen.
Praktisch war der junge Moses Mendelssohn sieben Jahre lang ein illegaler Einwanderer, der immer in Gefahr war, ausgewiesen zu werden, „… ohne Rechtsschutz, jederzeit, ohne Vorankündigung und Begründung“ (Geier, S. 175, a.a.O.).
Der vierzehnjährige Moses Mendelssohn war fast mittellos, immer hungrig, jedoch voller enormem Lerneifer und Wissensdrang. Eigentlich kam er nach Berlin um von dem von ihm hochverehrten, Rabbiners David Hirschel Fraenkel (1707-1762) weiter zu lernen. Dieser wurde erst kurz vorher aus Dessau als Oberland- und Stadtrabbiner nach Berlin berufen. Fraenkel fand für seinen Schüler eine erste Unterkunft; er besorgte für ihn auch Freitische und, bezahlte ihn für Abschriften seiner Arbeiten. So verschaffte Fraenkel ihm einen bescheidenen Erwerb. Mit Hilfe seiner geringen Ersparnisse kaufte sich Mendelssohn Bücher, auch um – insgeheim - Deutsch zu lernen. Denn seine Muttersprache war Westjiddisch.
Das Deutsch-Lernen war damals seitens der sich abkapselnden jüdischen Gemeinde verpönt, das Lesen von deutschen Büchern verboten, ganz unabhängig von deren Inhalt. Überliefert ist die Bestrafung des jungen Juden Bleichröder (des Großvaters von Bismarcks Bankier). Moses Mendelssohn unterrichtete ihn 1746 „… Lesen und Schreiben urteilte oft mit mir sein kümmerliches Brot. Aus Dankbarkeit zeigte ich mich ihm durch kleine Dienstleistungen erkenntlich, und so schickte er mich unter anderem irgendwohin, um ein deutsches Buch zu holen. Mit diesem Buch in der Hand begegnete mir ein jüdischer Armenvorsteher, der mich mit den Worten anfuhr: ‚Was hast du da? Wohl gar ein deutsches Buch!‘ Sogleich riss er es mir aus der Hand und schleppte mich zum Vogt, dem er den Befehl erteilte, mich aus der Stadt zu weisen“ (Bleichröder, zit. n. Knobloch, 1985, S. 56/57, a.a.O.). Tatsächlich musste der junge Jude unwiderruflich zur Strafe Berlin verlassen.
Moses fand für sich zudem Lehrer für Latein, neue Sprachen, Mathematik, Logik, Literatur und Philosophie, und er las und las: Moses Ban Maimon (Maimonides), John Locke, Lord Shaftesbury, Leibniz, Christian Wolff, die französischen Aufklärer.
In Lockes (lateinischer) „Epistola de tolerantia“ lernte Mendelssohn die Forderung nach einer Toleranzpflicht christlicher Obrigkeiten kennen: „Wenn wir den Juden als erhoben, Privathäuser und Wohnsitze unter uns haben, warum sollten wir ihnen nicht erlauben, Synagogen zu haben? Ist ihre Lehrer falscher, ihr Gottesdienst abscheulicher, oder ist der bürgerliche Friede mehr bedroht durch ihre Versammlung in der Öffentlichkeit als in ihren Privathäusern?“ (Locke, S. 59, a.a.O.).
Moses Mendelssohn arbeitete dann als Hauslehrer, später als Prokurist und Teilhaber bei einem jüdischen Seidenwarenfabrikanten in Berlin. Freundschaften verbanden ihn mit dem Buchhändler Nicolai und mit Lessing (der ihm im "Nathan" ein Denkmal setzte).
Mendelssohns „Philosophische Gespräche" erschienen 1755, es folgten u.a. seine "Briefe über die Empfindungen" und durch „Phädon" (oder "Über die Unsterblichkeit der Seele", 1767) wurde er berühmt. Seine damals sehr einflussreichen philosophischen Schriften sind heute überwiegend vergessen.
1780 – 83 wurde die Thora - Übersetzung von Moses Mendelssohn veröffentlicht Er übersetzte die hebräische Thora (das Alte Testament der Christen) ins Deutsche; er schrieb den deutschen Text noch in hebräischen Buchstaben, um ihn für seine Glaubensgenossen lesbar zu machen.
Nach Moses Mendelssohns Tod 1786 erwarb seine Frau das Haus. 1795 eröffnete Joseph Mendelssohn [5] in dem Haus sein Bankgeschäft.
Für den protestantischen Pfarrer Johann Caspar Lavater muss Mendelssohn ein großes Rätsel, ja ein existentielles Problem gewesen sein. Lavater muss fest überzeugt gewesen sein, dass jeder gebildete Mensch, von allein, durch Einsicht zu der überlegenen Glaubenswahrheit des Christentums finden müsse. Und nur der Christ könne ein wahrer, ganzer Mensch sein, das war (vermutlich) Lavaters Überzeugung. Mendelssohn aber war Jude, hielt an den religiösen Bräuchen seiner Väter fest, und brachte seine religiösen Vorstellungen in Einklang mit der Philosophie der Aufklärung, - für Lavater ein innerer Widerspruch. Deshalb wurde Mendelssohn von Lavater 1770 öffentlich aufgefordert, entweder in aller Form das Christentum zu widerlegen oder selber Christ zu werden.
Die darauf folgende öffentliche Auseinandersetzung zwischen Mendelssohn und Lavater, der „Lavater-Streit“, war für Mendelssohn heikel. Denn die Juden lebten – keineswegs nur in Preußen - knapp geduldet in einer dominierenden christlichen Gesellschaft und Mendelssohn wurde als Sprecher der jüdischen Minderheit betrachtet. Um das Gefühl einer Provokation zu vermeiden, war die Antwort von Mendelssohn war diplomatisch und klar. Er sei und bleibe von seiner Religion genauso überzeugt wie Lavater von der seinen. Mendelssohn, ergänzte, dass das Bestreben, Andersgläubige zu bekehren, dem Geist des Judentums fremd sei.
Bekanntlich setzte Lessing Mendelssohn Im Drama „Nathan der Weise“ ein literarisches Denkmal, auch Nathan ist Kaufmann und ein Weiser, ein aufgeklärter, aber bei seiner Religion bleibender Mensch, der jedoch die Wahrheit anderer Religionen akzeptiert. Auch Lessings Nathan misst die Religion an ihrem toleranten und friedlichen Verhalten. „Alle, die das Drama lasen oder wenig später auf der Bühne sahen, wussten, dass diese vorbildliche Gestalt, die Vernunft, Barmherzigkeit, Toleranz und Liebe verkörperte, den berühmten jüdischen Philosophen aus Berlin darstellte“ (Feiner, S. 119, a.a.O.).
Vielfach nehmen Literaturhistoriker an, dass Lavater im „Nathan der Weise“ in Daja dargestellt wird. Daja, die Gesellschafterin von Nathans angenommener Tochter Recha, ist Christin. Ihr Glaubenseifer, ihr Wunderglauben und ihre Bekehrungsversuche lassen sie als Verkörperung des Bildes zu erkennen, das Lessing von Lavater in der Streit mit Mendelssohn bekommen hatte.
Lessingurteilte 1770 über Lavater: „Lavater ist ein Schwärmer, als nur einer des Tollhauses wert gewesen“ (Lessing zit. n. Knobloch, 1985, S. 207, a.a.O.).
Das Haus Mendelssohns wird, wie große Teile der Mitte Berlins, von den Bomben des 2. Weltkriegs zerstört. Um den ungefähren Standort des Hauses heute zu erahnen, liest man bei Heinz Knobloch: “Wie dem auch sei, wir stehen auf historischem Boden, wenn wir an der Ecke Spandauer Straße auf grünes Licht warten. Im Rücken den Fernsehturm, vor den Augen den Palast der Republik” (Knobloch, 1985, a.a.O.).
Auf dem früheren Grundstück Spandauer Straße 68 soll nach Plänen des israelischen Künstlers Micha Ullman ein Denkmal für den Philosophen Moses Mendelssohn entstehen
Station 5: Ehem. Neuer Markt (vgl. Karte Nr. 9)
Aufgrund einer (angeblichen) Hostienschändung werden nach Folter und Prozess 39 märkische Juden (darunter ein Rabbiner) zum Tode verurteilt und am 19. Juli 1510 auf dem Neuen Markt in Berlin (vor der Marienkirche, vgl. Karte Nr. 9) verbrannt. Alle weiteren Berliner und märkischen Juden werden ausgewiesen.
Philipp Melanchthon enthüllte hingegen auf dem Frankfurter Ständetag 1539 die Unschuld der in Berlin verbrannten Juden.
Im Jahre 1543 berief der brandenburgische Kurfürst Joachim II. (1535 -1571) Michael von Derenberg, einen bereits berühmten jüdischen Händler, als "Hoffaktor“ [6] nach Berlin. Er wohnte in einem Haus in der Klosterstraße (vgl. Karte Nr. 10) in Berlin und blieb bis zu seinem Tod (durch einen geheimnisvollen Unfall) ein Vertrauter des Kurfürsten.
Joachim II. ernennt 1556 Lippold, einen Prager Juden, zum "Obersten aller märkischen Juden", zum kurfürstlichen „Schatullenverwalter' und zum brandenburgischen Münzmeister: ein Vertrauter des Kurfürsten und auch ein politisch sehr einflussreicher Mann.
Nach dem plötzlichen Tod des Kurfürsten im Köpenicker Schloss werden am 2./3. Januar 1571 alle Günstlinge, Mätressen und auch Lippold von dem neuen Kurfürsten Johann Georg verhaftet. In Berlin kommt es zu Pogromen, jüdische Häuser werden geplündert, die Synagoge zerstört. In einer langen Untersuchung stellt sich heraus, dass Lippold ein gewissenhafter ehrlicher und treuer Mitarbeiter Joachims gewesen war: der Kurfürst schuldete ihm sogar noch Geld.
Nun wird Lippold Zauberei vorgeworfen: er wird gefoltert und gesteht schließlich alles, was seine Gegner hören wollen: er habe den Kurfürsten bestohlen und vergiftet. Lippold wird zum Tode verurteilt. Auf dem Neuen Markt zu Berlin (vgl. Karte Nr. 9) wird er 1573 zehnmal mit glühenden Zangen gerissen, dann gerädert und gevierteilt (ein klarer Justizmord!). Darüber hinaus ordnet der Kurfürst die Vertreibung aller Juden aus der Mark Brandenburg an. Für die Ausweisung mussten die Juden noch Geld bezahlen, so genannte „Abzugsgelder". In der Folge waren die Mark und Berlin "judenfrei".
Neben der Marienkirche befindet sich ein unter Denkmalschutz stehendes Lutherdenkmal des Bildhauer Robert Toberentz, das 1895 auf dem Neuen Markt feierlich eingeweiht wurde. Ursprünglich zeigt das Denkmal auch noch eine Reihe von Begleitfiguren, die aber im 2. Weltkrieg eingeschmolzen wurden. Erst im Oktober 1989, anlässlich des 450. Jahrestages der Einführung der Reformation in der Mark Brandenburg, wurde die erhalten gebliebene Luther-Figur nördlich der Kirche, nahe dem Ursprungsort wieder aufgestellt.
Bislang gibt es keine kritische Kommentierung des Denkmals wegen der verhängnisvollen Rolle, die der Reformator durch seine antijudaistischen Schriften spielte.
Das Lutherdenkmal soll im „Reformationsjahr 2017“ an seinen prominenteren alten Standort auf dem Neuen Markt vor der Kirche zurückkehren.
Station 6.: Heidereutergasse – Rosenstraße (vgl. Karte Nr. 12)
In der Regierungszeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. (des „Großen Kurfürsten“, 1640 - 88) lebte anfangs nur ein „Hofjude", Israel Aaron, in Berlin - Cölln: seine Aufgabe war der Import von den Waren und Geräten für Armee und Hof, die nicht in Brandenburg hergestellt wurden. Am 26. Januar 1665 erließ des "Große Kurfürst" einen erneuter Schutzbrief für Israel Aaron: es wird darin betont, dass er Freizügigkeit genieße und nur der kurfürstlichen Jurisdiktion unterstehe.
Am 19. Mai 1671 erließ Kurfürst Friedrich Wilhelm I. ein Edikt, nach dem sich fünfzig jüdische Familien aus Wien (wo sie vertrieben worden waren) für 20 Jahre in Berlin niederlassen durften. Ihre Ansiedlung sollte im Rahmen der merkantilistischen Politik Handel und Wandel in Berlin fördern. Die Familien wohnten anfangs im alten Judenhof an der Königsstraße, in der Nähe der heutigen Jüdenstraße (vgl. Karte Nr. 11). Die jüdischen Einwanderer aus Wien beschäftigten sich u.a. mit dem Kopieren der abgelegten Kleider und Uniformen des Hofes. Aus dieser Wurzel entwickelten sich die ersten Konfektionshäuser um den Hausvogteiplatz, die bis 1933 berühmt waren.
Am 12. September 1671 wurde ein kurfürstliches Privilegiums an Israel Aaron und seine Familie erteilt: er erhält das Recht in Berlin, Cölln oder Friedrichswerder ein Haus zu kaufen und wird von der Einquartierung befreit. Er und seine Familie werden von der Zahlung des "Leibzolls" [7] befreit, müssen aber ein Schutzgeld von jährlich 8 Reichsthalern zahlen.
Am jüdischen Neujahrstag 1714 wird eine erste neue Synagoge der Berliner jüdischen Gemeinde in Anwesenheit von Königin Sophie Dorothea und preußischer Minister [8] eröffnet: in der Heidereutergasse; die einst die Spandauer Straße mit der Rosenstraße verband (im 2. Weltkrieg wurde diese Synagoge von Bomben zerstört; später wurde dort ein Parkplatz angelegt, heute befindet sich dort eine Grünanlage; vgl. Karte Nr. 12). Die Synagoge – ein schlichter Saalbau – durfte nicht höher sein als die Bürgerhäuser, weshalb der Hauptraum unter das Straßenniveau gelegt wurde und so höher war.
Nach der sog. „Fabrikaktion" am 27./28. Februar 1943 (bei der mehr als 7000 jüdische Zwangsarbeiter aus der Rüstungsindustrie direkt nach Auschwitz deportiert wurden) brachte die Gestapo alle nach faschistischer Terminologie „arisch versippten" jüdischen Berliner in das Verwaltungsgebäude der Jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße (später bombardiert und zerstört, vgl. Karte Nr. 12). Es handelte sich um ca. 1500 Männer, Frauen und Kinder. Daraufhin demonstrieren täglich eine Woche lang mehrere hundert Ehefrauen und Freunde mit Sprechchören vor dem Gebäude. Eine ähnliche Aktion wurde auch vor dem Altersheim in der Großen Hamburger Straße durchgeführt. Eine Delegation wurde zur Gestapo-Leistelle in der Burgstraße 26 (vgl. Karte Nr. 17), wo sich auch das „Berliner Judenreferat“ befand. Schließlich erreichten die Protestierenden am 6. März 1943 die Freilassung ihrer Angehörigen. Diese Demonstrationen waren die einzige öffentliche kollektive gewaltlose Protestaktion gegen die Deportationen, die jemals im faschistischen Deutschland stattfanden.
Jahrzehntelang blieb die Aktion der Frauen von der Rosenstraße weitgehend unbeachtet. Erst in den achtziger Jahren informierte eine Ausstellung von Studenten der HUB über die Protestaktionen (vgl. die vor Ort befindlichen Litfaßsäulen).
Anfang der 90er Jahre schuf die Berliner Bildhauerin, Jüdin und Kommunistin Ingeborg Hunzinger (1915 – 2009) ihr Skulpturen–Ensemble „Block der Frauen“ mit Figurengruppen, Symbolen und szenischen Darstellungen, das in der Grünanlage [9] der Rosenstraße zum Gedenken an die erfolgreichen Proteste 1995 aufgestellt wurde.
Station 7.: Hackescher Markt (vgl. Karte Nr. 1)
Am 9./10. November 1938, bei dem staatlich organisiertem Pogrom (euphemistisch "Reichskristallnacht" genannt) wurden über 3 700 jüdische Geschäfte wurden von SA-Angehörigen und anderen Nazis zerstört und z.T. geplündert, 10 000 jüdische Deutsche wurden festgenommen und ins KZ Sachsenhausen gebracht. Zahlreiche jüdische Deutsche wurden bei den Pogromen ermordet. Gegen die Pogrome gab es durch die Berliner Bevölkerung keinen nennenswerten Widerstand oder offen artikulierten Unmut.
Neun Berliner Synagogen standen in der Nacht in Flammen, wurden total zerstört. Auch in der Neuen Synagoge in der Oranienburgerstraße in Mitte loderte im Trausaal bereits das Feuer, gelegt von einer Gruppe von SA-Männern, z.T. in „Räuberzivil“.
Der „beherzte Reviervorsteher“ Polizeioberleutnant Wilhelm Krützfeld (1880 -1953, Abb. s.o.) [10] vom Polizeirevier 16 am Hackeschen Markt 1 war seit April 1937 Leiter der Polizeiwache 16 an der Ecke Rosenthaler Straße / An der Spandauer Brücke [11]. Telefonisch erhielt er gegen 0.30 Uhr die Nachricht von der Brandstiftung. Krützfeld bewies in der Nacht zum 10. November 1938 lebensgefährliche Zivilcourage und stellte sich mit weiteren Beamten seines Reviers den Brandstiftern entgegen, obwohl er wusste, dass es sich um einen staatlich gelenkten und erwünschten Pogrom handelte. Sie vertrieben die Brandstifter und verhinderten die Zerstörung der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Die Brandverhinderung am 10. November rekonstruierte Heinz Knobloch wie folgt: „SA-Leute waren
eingedrungen und hatten Feuer gelegt. Doch nicht lange, da erschien der Vorsteher des zuständigen Polizeireviers mit ein paar Mann am Tatort und verjagte die Brandstifter. Mit vorgehaltener Pistole und einem Aktendeckel, in dem sich ein Schriftstück befand, das den bedeutenden Kunst- und Kulturwert des Gebäudes unter polizeilichen Schutz stellte. Gleichzeitig beorderte der Polizeioffizier die Feuerwehr zur Brandstelle. Die kam auch und löschte, was ebenfalls bemerkenswert war angesichts der Situation im Deutschen Reich. Die meisten Feuerwehren standen untätig wie befohlen oder griffen nur ein, wenn die Flammen auf die nichtjüdische Nachbarschaft überzuschlagen drohten.” (Knobloch, 1993, a.a.O., S.7).
Die Synagoge blieb erhalten, nach Aufräumungsarbeiten fanden bereits im Frühjahr 1939 in der Neuen Synagoge wieder Gottesdienste statt.
Wilhelm Krützfeld wurde weder verhaftet oder entlassen. Er wurde am Tage darauf durch den damaligen Polizeipräsidenten Wolf-Heinrich Graf von Helldorff (1896 – 15. August 1944, hingerichtet in Plötzensee) verbal gemaßregelt, obwohl für ähnliche Taten damals durchaus scharfe Sanktionen üblich waren. Artur Krützfeld, der jüngste Sohn Wilhelms, erinnerte sich, dass der Polizeipräsident seinem Vater vorwarf, durch sein Handeln den „gesunden Volkswillen zu unterdrücken“.
Bekannt wurde später, dass Krützfeld auch darüber hinaus in dem Revierbereich 16 wohnenden Juden behilflich war. Er und einige andere Polizisten des Reviers warnten mehrfach Juden vor ihrer Verhaftung. Der Leiter der Meldestelle, Willi Steuck, und der Polizist Otto Bellgardt stempelten gefälschte Ausweise und warnten vor geplanten Deportationen. Auch Otto Weidt kannte Polizisten des Reviers und wurde vor Razzien gegen Juden gewarnt.
Zur Strafe (??) wurde Krützfeld später das Revier 16 entzogen. Ab 1940 wurde als „Springer" Krützfeld in andere Reviere versetzt. Am 1. November 1943 ging er nach 36 Jahren Polizeidienst auf eigenen Wunsch „aus gesundheitlichen Gründen“ in den Ruhestand.
Im Jahre 1945 trat Wilhelm Krützfeld bei dem Neuaufbau der Polizei wieder in den Polizeidienst ein. Bis zum Juni 1947 leitete er die Inspektion Mitte im sowjetischen Sektor Berlins.
Dass man heute überhaupt von Wilhelm Krützfeld weiß, ist dem Journalisten und Schriftsteller Heinz Knobloch zu verdanken. Der jüngste Sohn Wilhelms, Artur Krützfeld, hatte 1985 Knobloch per Anruf auf die Spur seines Vaters gebracht. Knobloch stellte damals Nachforschungen über den unbekannten mutigen Polizisten an und setzte ihm erst in der „Wochenpost“ und dann in seinem Buch „Der beherzte Reviervorsteher“ (a.a.O.) ein Denkmal.
Mit einer Sonderausstellung in der Polizeihistorischen Sammlung am Platz der Luftbrücke wurde 1995 Revieroberleutnant Wilhelm Krützfeld geehrt.
Die Autoren von Wikipedia urteilten meinten zu Wilhelm Krützfeld: „Er war weder ein Verfolgter des Naziregimes noch ein Widerstandskämpfer, er war weder Sozialdemokrat noch Kommunist, er war weder ein klassischer Held noch ein Märtyrer. Vielleicht macht ihn gerade das so bedeutend. Wilhelm Krützfeld war, das zeigen Zeitzeugen und Indizien deutlich, ein (preußischer) Polizeibeamter, der sich dem Staate als einem Ordnungssystem zur Mehrung von Toleranz und menschlichem Wohlergehen verpflichtet fühlte. Ein Mann mit gesundem Menschenverstand und Zivilcourage, der es durch „großen Fleiß und Pflichttreue“ vom Polizeiobermeister zum „Schutzpolizeiinspektor im Revierdienst“ (später „Revier-Oberleutnant“) und Reviervorsteher brachte.“ (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Kr%C3%BCtzfeld).
Warum war der öffentliche Widerstand von Wilhelm Krützfeld gegen die Pogrome vielleicht der einzige verbürgte Fall? Vermutlich nicht aus antisemitischem Hass und auch nicht nur wegen der Hoffnung auf Plünderungen und Beute. Der ostdeutsche Historiker Kurt Pätzold (* 1930) verwies darauf, dass Pogrome auch die Wirkung haben, sich psychisch „abzuhärten“ gegen das, was anderen angetan wurde, Empathie abzubauen. Die Brutalität der kommenden Kriege sollte vorweggenommen, eingeübt werden, nicht notwendig durch Mitmachen, aber durch duldendes Zu- und Wegschauen, durch Hinnahme in einer angst-lustvollen Unterwerfung (vgl. „Junge Welt“ 8.11.2008).
Station 8.: Ehemalige Blindenwerkstatt Otto Weidt (Rosenthaler Straße 39, vgl. Karte westlich von Nr. 4)
Otto Weidt (1883 – 1947) war ein pazifistischer Kleinunternehmer, der im 2. Weltkrieg seine betrieblichen und privaten Möglichkeiten unter Lebensgefahr zur Rettung von Juden benutzte.
Der Betrieb stellte Bürsten und Besen her, da er u.a. für die Wehrmacht arbeitete, galt er als „wehrwichtig“. Die meisten der ca. 30 Arbeiter, die Weidt beschäftigte, waren blinde oder taubstumme Juden, die seit 1941 zur Zwangsarbeit verpflichtet waren. U.a. waren auch Alice Licht und die Schriftstellerin Inge Deutschkron in der Werkstatt von Otto Weidt beschäftigt. In ihrem Buch „Ich trug den gelben Stern“ berichtete sie von dieser Zeit. Inge Deutschkron die von 1941 bis 1943 als Sekretärin in der Blindenwerkstatt arbeitete, überlebte v.a. durch Scheinidentitäten, die ihr Weidt verschaffte. Nur durch die Hilfe von insgesamt 20 mutigen Berlinern, die ihr halfen und sie versteckten, konnte sie überleben (vgl. „Tagesspiegel“, 11. Dezember 2006).
Die Werkstatt Otto Weidts war für eine Reihe von jüdischen Berlinern der letzte Zufluchtsort vor der Deportation. Weidt versorgte „seine“ Arbeiter mit zusätzlichen Lebensmitteln, die er auf dem schwarzen Markt erwarb. Um Juden zu retten, bestach Otto Weidt Gestapo-Mitarbeiter und -Spitzel, besorgte falsche Papiere und organisierte illegale Verstecke.
Weidt selbst ging im Februar 1942 zum Deportationssammellager in der Großen Hamburger Straße, um „seine Arbeiter“ zurückzuholen. Zeugen sahen, wie er die Blinden (und Taubstummen) aus der Großen Hamburger über die Oranienburger in die Rosenthaler Straße zurückführte. Er an der Spitze, hinter ihm seine jüdischen Arbeiter, einer den anderen stützend, noch in der Arbeitskleidung mit dem „Judenstern“ an der Lederschürze, in der sie geholt worden waren (vgl. Tagesspiegel, 11. Dezember 2006).
Weidt versuchte, das Leben der Familie Chaim Horn zu retten. Vater und Sohn arbeiteten in seiner Werkstatt. Als die Familie die Aufforderung zur Deportation („Abwanderung“) erhalten hatte, baten sie Otto Weidt, er möge sie verstecken. Weidt versteckte die in dem letzten Raum der Blindenwerkstatt, einer etwa 10 m2, fensterlose Abstellkammer für die vierköpfige Familie. Das Versteck tarnte ein vor die Tür geschobener Schrank. Schob man im Schrank die Kleidung beiseite, konnte die Rückwand des Schrankes entfernt werden. Für acht Monate, vom Februar 1943 bis zum 5. Oktober 1943 lebten die Horns im Versteck. Beide Verstecke, das der Horns und das der Lichts, wurden durch einen jüdischen Spitzel (einem „Greifer“) verraten, den Vater Horn kannte und auf der Straße bei einem Spaziergang traf. Familie Horn wurde nach Auschwitz deportiertund ermordet- Wer die Verstecke verriet, ist bis heute unklar geblieben..
Nach diesem Vorfall wurde auch Otto Weidt verhaftet, rettete sich jedoch (mit Glück und Bestechungen) mit der Behauptung, er habe von den Verstecken der Familien Horn und Licht nichts gewusst, denn er sei selber stark sehbehindert.
In der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem wurde Otto Weidt 1971 als einer der „Gerechten unter den Völkern“ registriert.
Die Berliner Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Regina Scheer (a.a.O.) veröffentliche als Erste in der DDR 1984 einen Artikel über die Blindenwerkstatt.
Durch den Senat von Berlin wurde 1994 das Grab Otto Weidts in Zehlendorf, Onkel – Tom – Straße, zum Ehrengrab erklärt. Ebenfalls seit 1994 befindet sich am Hofeingang eine Gedenktafel für Otto Weidt.
Seit 1998 / 99 befindet sich in den Räumen der ehemaligen Werkstatt die Ausstellung „Blindes Vertrauen – Versteckt am Hackeschen Markt 1941 – 43“. Sie wurde von StudentInnen des Studiengangs Museumskunde der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) Berlin erarbeitet. Auch das ehemalige Versteck der Familie Horn ist für Besucher zugänglich gemacht worden.
Heute ist die Werkstatt eine Dependance der Stiftung Jüdisches Museum Berlin. Im Vorderhaus befindet sich die Gedenkstätte „Stille Helden“.
Inge Deutschkron berichtete auch über die unglaubliche Rettungsgeschichte von Alice Licht (1916 - 1987), die in der Blindenwerkstatt Otto Weidts Sekretärin war, und die er liebte. Für Alice und ihre Eltern mietete er 1943 einen Lagerraum in der Neanderstraße (heute: Heinrich-Heine-Straße) in Mitte; hinter dort gelagerten Besen und Bürsten konnten die drei Personen versteckt leben, bis auch ihr Versteck verraten wurde. Alice und ihre Eltern wurden am 15. November 1943 gemeinsam mit 41 weiteren Berliner Juden mit dem „98. Alterstransport“ nach Theresienstadt (s.o. vgl. http://www.statistik-des-holocaust.de/AT98-1.jpg) deportiert, wohin Otto Weidt regelmäßig Lebensmittelpakete sandte.
Am 16. Mai 1944 schrieb Alice unterwegs im Transport von Theresienstadt ins Vernichtungslager Birkenau bei Auschwitz eine unfrankierte Ansichtskarte mit dem Foto des Berghofs, Hitlers Sitz in den bayerischen Alpen.
Adressiert war die Postkarte an die Blindenwerkstatt. Sie warf die Karte mit dem Hinweis - „Finder wird gebeten Karte in Briefkasten zu stecken. Vielen Dank!“- .aus dem Zug. Als ordentliche Deutsche versprach sie der Post, dass der Empfänger das Strafporto bezahlen werde (vgl. „Spiegel“, 42/2000). Alices Eltern wurden in Auschwitz ermordet, sie selbst kam nach Christianstadt (heute: Krzystkowice, am Westufer des Bober), in ein Nebenlager des KZ Groß-Rosen.
Ein unbekannt gebliebener Finder aber steckte die Postkarte tatsächlich in einen Briefkasten, sie erreichte ihren Empfänger in der Blindenwerkstatt. Weidt wusste, dass Alice im Frühjahr 1944 tödlich bedroht war. Um sie zu retten, griff er zu einem Vorwand. Am 9. Juni 1944 schrieb er an die Verwaltung des KZs Auschwitz, betonte seine Verdienste als Lieferant von Qualitätswaren für Arbeitslager und die Berliner Gestapo und bat darum, „Offerten in unseren Waren zu machen".
Die listige Offerte hatte Erfolg, die SS gewährte Weidt die Erlaubnis, die Waren aus seiner Produktion persönlich in Auschwitz vorzuführen. Rasch fand Weidt in Auschwitz heraus, das Alice Licht mittlerweile nach Christianstadt verlegt worden war. In Christianstadt gelang es Weidt über einen polnischen Zivilarbeiter zu Alice Kontakt aufzunehmen. Brieflich informierte er sie, dass er ein Zimmer in der Stadt angemietet habe. Weidt zahlte mehrere Mieten im Voraus und hinterlegte in dem Zimmer Geld und Kleidung für Alice.
Als im Januar 1945 wurde das KZ Groß-Rosen durch die SS evakuiert wurde, gelang Alice Licht die Flucht nach Berlin. Die Befreiung Berlins erlebte Alice in der Wohnung der Weidts in Berlin Zehlendorf.
Später emigrierte Alice Licht in die USA und nach Israel.
Station 9.: Große Hamburger Straße („Toleranzstraße“, vgl. Karte Nr. 2- 5)
Im Jahre 1672 erfolgte der Ankauf des Geländes in der Großen Hamburger Straße, wo der Jüdische Friedhof (vgl. Karte Nr. 3) eingerichtet wird; er wird bis 1827 benutzt. Auf dem nur ca. 0,59 ha großen Gelände wurden in den ca.150 Jahren etwa 12 000 Menschen beerdigt, u.a. auch Moses Mendelssohn und Veitel Heine Ephraim.
Die Jüdische Gemeinde tritt im Jahre 1712 einen Teil ihres Begräbnisplatzes zum Bau der Sophienkirche und des (christlichen) Sophienfriedhofs ab. Die „Kirchgasse“, der später Sophienstraße genannte Straßenzug, diente als „Zubringer“ zur Sophienkirche. Auf dem Friedhof der Sophienkirche liegen u.a. die Gräber des bedeutenden Historikers Leopold von Ranke (1795 -1886), des Maurermeisters und Komponisten Karl Friedrich Zelter [12] und der Dichterin Anna Louisa Karsch ( „die Karschin“, 1722 - 1791) .
1778 eröffnet die von David Friedländer und Isaac Itzig gegründete "Jüdische Freyschule": erstmals wird Unterricht in deutscher Sprache erteilt. Aus ihr entwickelt sich später die jüdische Knabenschule (heute mit einer Gedenktafel für Moses Mendelsohn; vgl. Karte Nr. 5)
Das erste Altersheim der jüdischen Gemeinde wird 1844 in der Großen Hamburger Straße (vgl. Karte, Nr. 2) errichtet; der benachbarte ehemalige Jüdische Friedhof wird als Park benutzt.
In dem ehemaligen jüdischen Altersheim in der Großen Hamburger Straße richtet 1942 die Gestapo eines der berüchtigten Sammellager ein, in denen zehntausende jüdischer Deutscher zur Deportation zusammen getrieben wurden. Heinrich Stahl, der frühere Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, wird nach Theresienstadt deportiert, wo er schon nach 5 Monaten den Haftbedingungen erlag.
Auf dem ehemaligen – von den Nazis zerstörten - jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße werden im April / Mai 1945 zahlreiche Soldaten und Zivilisten in Massengräbern beerdigt (vgl. Gedenktafel), um Seuchen vorzubeugen: dieser jüdische Friedhof ist daher einer der wenigen, auf dem auch Nicht–Juden beerdigt wurden.
Das Grab von Moses Mendelsohn (vgl. Karte Nr. 4)auf dem Friedhof wurde wiederhergestellt.
Zur Erinnerung an das Altersheim und die Deportationen von ca. 55 000 Berliner Juden wurde 1985 am Eingang zum Friedhof eine Figurengruppe nach Entwürfen von Will Lammert (+ 1957) aufgestellt.
Gegenüber der Schule, in der Baulücke des Hauses Nr. 15/16 entstand 1990 die Installation „The Missing House“: Der Künstler Christian Boltanski brachte an den übrig gebliebenen Brandwänden Tafeln an, die die Namen, Daten, Berufe der ehemaligen Bewohner der Hauses angeben. Allein von den Namen her wird deutlich, wie multikulturell diese Region schon in der Zeit vor dem Faschismus gewesen sein muss.
Station 10.: Neue Synagoge – Oranienburger Straße (vgl. Karte, Nr. 7 & 8.)
Am 5. September 1866 erfolgte die Einweihung der prächtigen Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße (vgl. Karte, Nr. 7) nach mehr als siebenjähriger Bauzeit. Die Entwürfe für die Synagoge fertigte Eduard Knoblauch (1801 - 1865), den Bau leitete Friedrich August Stüler (1800 - 1865).
In der Neuen Synagoge wird ein reformierter Kultus praktiziert, der schwere Konflikte innerhalb der Berliner Judenheit auslöste: der hebräische Gottesdienst wurde von einer Orgel und einem gemischten Chor begleitet. Einige Gebete wurden in der deutschen Landessprache gesprochen.
Die hebräische Eingangsinschrift an der Neuen Synagoge („Pitchu sch’arim w-jago goi zadik schomer emunim“ = „Öffnet die Tore, und es kommt das gerechte Volk, das die Treue bewahrt“, Jesaja, 26,2) wurde von den Gegnern der Kultusreform anders gelesen und interpretiert: sie ließen hinter dem Begriff „goi“ (Nichtjude) eine Zäsur, so dass der Text nun ergab: „Öffnet die Tore und es kommt der Nichtjude, der Gerechte wahrt die Treue“.
Die konservative Gruppe des Berliner Judentums schließt sich 1869 zur Separatgemeinde "Adass Jisroel" zusammen. Das Rabbinerseminar der orthodoxen "Adass Jisroel", zuerst in der Gipsstraße, später in der Artilleriestraße, war eine Anlaufstelle für die frommen jüdischen Immigranten.
Am 9. / 10. November 1938, bei dem staatlich organisiertem Pogrom ("Reichskristallnacht") kam es auch in Berlin - Mitte zur Plünderung und Zerstörung von Geschäften und Wohnungen, Verhaftung und Ermordung zahlreicher jüdischer Deutscher. Der „beherzte Reviervorsteher“ Wilhelm Krützfeld (1880 -1953) vom Polizeirevier 16 am Hackeschen Markt 1 vertrieb die Brandstifter und verhinderte die Zerstörung der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Nach Aufräumungsarbeiten finden bereits im Frühjahr 1939 in der Neuen Synagoge wieder Gottesdienste statt.
Das Bild der Neuen Synagoge, bei der aus der Kuppel die Flammen schlagen, wird gern zur Illustration der Gräuel des Pogroms benutzt. Das ist aber irreführend. denn das Bild entstand nach einem englischen Luftangriff am 22.November 1943: Die Neue Synagoge wurde getroffen und brannte aus. Die Reste des Hauptraumes werden Ende der 50er Jahre abgetragen.
Im Juli 1988 wird der „Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum“ gegründet, die es sich zur Aufgabe setzte, die Neue Synagoge als bleibendes Mahnmal wiederaufzubauen und ein Zentrum für die Pflege und Bewahrung jüdischer Kultur zu schaffen. Auch begann man den Wiederaufbau der Neuen Synagoge als Centrum Judaicum.
Erich Honeckersetzte selbst sich an die Spitze der Stiftung „Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum". die Gründung dieser Stiftung in der DDR, hatte v.a. außenpolitische Gründe: Die Staatsspitze suchte Kontakt zu den USA, und man hoffte über den Jüdische Weltkongress eine Brücke dorthin zu schlagen.
Am 29. Oktober 1990 erfolgt die Montage des letzten Segments der wiederhergestellten Hauptkuppel der Neuen Synagoge; eine Richtkrone wird feierlich hochgezogen, und am 5. Juni 1991 schmückt der „Magen David“, der Davidsstern wieder die Hauptkuppel der Neuen Synagoge.
Zeittafel zur Geschichte der Juden in Berlin
Beginn d. 13. Jhdts.: Das früheste Wohngebiet jüdischer Berliner befand sich nahe der heutigen Jüdengasse. Vermutlich schon im 13.Jhdt. hatten sich nordöstlich des Molkenmarktes einige jüdische Familien angesiedelt.
Jüdische Kaufleute gehörten vielleicht mit zu den Stadtgründern. Die Jüdenstraße könnte mit der Anlage der Stadt um 1220/30, entstanden sein. Wahrscheinlich errichteten schon frühe jüdische Einwanderer den Großen Jüdenhof, eine mittelalterliche Wohnanlage. Vermutet wurde auch die Existenz einer nahegelegenen Synagoge und Mikwe.
1230: Errichtung der Petrikirche in (Alt-) Cölln; sie wurde in ihrer Geschichte mehrfach um- und neugebaut; ihr Turm war seit 1852 mit einer Höhe von 111 m lange Zeit das höchste Gebäude der Stadt.
1244 bis
1474: Aus diesem Zeitraum stammen erhalten gebliebene 75 Grabsteine des ältesten jüdischen Friedhofs Berlin nahe dem heutigen Alexanderplatz. Nach dessen Zerstörung (um 1510) blieben
Grabsteine des Friedhofs teilweise erhalten, da sie als Baumaterial in der Spandauer Zitadelle benutzt wurden. In der Zitadelle sind nach Restaurationsarbeiten einige dieser Grabsteine wieder sichtbar gemacht worden.
Die Existenz dieses Friedhofs am Alexanderplatz ist jedoch umstritten: u.U. nutzten die Berliner Juden auch den jüdischen Friedhof in Spandau („Judenkiewer“) nordwestlich der Altstadt.
ca. 1270-90: Bau der später mehrfach umgebauten „Gerichtslaube“ an der heutigen Ecke Spandauer Damm/Rathausstraße; es handelt sich um den ältesten profanen Steinbau der Stadt Berlin. Die Gerichtslaube ist ein beinahe quadratischer Backsteinbau, eine nach außen mit Spitzbogenarkaden geöffnete, ursprünglich einstöckige Halle. Das Kreuzgewölbe der Halle ruht auf einem mittleren Rundpfeiler, der u.U. an den einstigen Gerichtsbaum auf Thingplätzen erinnert. Spätestens im 16. Jhdt. wird ein oberes mit einem Netzgewölbe geschmücktes Stockwerk aufgesetzt, das „Rathausstuhl“ genannt wird. Im unteren Bereich befinden sich romanische Stuckreliefs, die menschliche Laster und Leidenschaften symbolisieren. An der Außenwand des Gebäudes befand sich der Galgen, der Pranger zu bestrafende Ausstellung verurteilter und der Kaak: eine das spotten der Publikum symbolisieren der Vogelgestalt mit grinsende Menschen Gesicht und Eselsohren. Mündliche Rechtsausübung in der offenen Halle, an der alle Bürger teilnehmen konnten, wurde dann mit der Einführung der Reformation in Brandenburg, Mitte des 16. Jahrhunderts, durch schriftliche Verfahren des römischen Rechts abgelöst. Der Pranger allerdings erhielt vorerst seine Bestimmung“ (vgl. Tagesspiegel, 3. Januar 2015, S. 27).
1295: Erste urkundliche Erwähnung von Juden in Berlin
um 1350: Die Pest erreicht Berlin; auch hier wird den Juden die Schuld gegeben und in der Folge kommt es zur ersten Judenverfolgung und -vertreibung in Brandenburg und Berlin.
1415: Der erste Hohenzollern-Kurfürst, Friedrich I., bringt aus Nürnberg zwei jüdische Ärzte in seine neue Residenz Berlin und Cölln mit.
1510: Aufgrund einer (angeblichen) Hostienschändung werden nach Folter und Prozess 39 märkische Juden (darunter ein Rabbiner) zum Tode verurteilt und am 19. Juli 1510 auf dem Neuen Markt in Berlin (vor der Marienkirche, vgl. Karte Nr. 9) verbrannt. Alle weiteren Berliner und märkischen Juden werden ausgewiesen: Erste Zerstörung der Jüdischen Gemeinde in Berlin.
1539: Philipp Melanchthon enthüllt auf dem Ständetag in Frankfurt am Main die Unschuld der in Berlin verbrannten Juden. Der wahre Hostiendieb, ein Christ, hatte die Juden beschuldigt, um von seiner Tat abzulenken. Jedoch hatte er den Diebstahl in einer Beichte gestanden, der Beichtiger, der Brandenburger Bischof, hatte jedoch den Justizmord nicht verhindert. In der Folge werden Juden wieder in der Mark und Berlin zugelassen. Später wurde der Kleine Jüdenhof mit einer Synagoge in der nördlichen Klosterstraße (heute nördlich der Karl-Liebknecht-Straße) errichtet.
Januar 1543: Martin Luther publiziert in Wittenberg seine antijudaistische Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“, die viel negative Stereotypen vom „verstockten, teuflischen Juden“ tradiert und verstärkt (vgl. Thomas Kaufmann, a.a.O.). U.a. schlägt Luther als „scharfe Barmherzigkeit“ vor, man solle…
· die Synagogen niederbrennen,
· jüdische Häuser zerstören und sie aus den evangelischen Ländern „wie die tollen Hunde“ verjagen,
· jüdische Gebetbücher und Schriften wegnehmen, sie lehrten nur Abgötterei,
· den Rabbinern das Lehren bei Androhung der Todesstrafe verbieten,,
· ihnen das „Wuchern“ verbieten, ihren Besitz einziehen.
· den jungen kräftigen Juden Werkzeuge für körperliche Arbeit geben und sie ihr Brot verdienen lassen.
März 1543: Luther publiziert die verschwörungstheoretische Schrift „Vom Schem Hamphoras“, die langfristig wirksam blieb: Luther bezeichnete die Juden als eine „Grundsuppe aller losen, bösen Buben, aus aller Welt zusammengeflossen“. Sie hätten sich „wie die Tattern und Zigeuner“ (Tataren und Roma) zusammengetan, um die Christenheit auszuspionieren, Wasser zu vergiften, Kinder zu stehlen und allerlei Schaden anzurichten. Wie die Assassinen würden sie Morde an christlichen Regenten begehen, um deren Herrschaft zu übernehmen.
Auch rechtfertigt Luther in dieser Schrift die Darstellungen der „Judensau“.
1543: Der luxusliebende, stets verschuldete Kurfürst Joachim II. (1535 - 1571) beruft Michel von Derenburg, einen bereits berühmten jüdischen Händler, als“ Hoffaktor“ nach Berlin. Er wohnt in einem Haus in der Klosterstraße (vgl. Karte Nr. 10) in Berlin und blieb bis zu seinem Tod 1549 (durch einen geheimnisvollen Treppensturz in seinem Berliner Haus) ein Vertrauter des Kurfürsten. Der „reiche Michel“ pflegte zuweilen zwölfspännig und mit pompöser Dienerschaft zu reisen.
1556: Joachim II. ernennt Lippold ben Chluchim, einen Prager Juden, zum “Obersten aller märkischen Juden“, zum kurfürstlichen „Schatullenverwalter“ und zum brandenburgischen Münzmeister: er ist ein Vertrauter des Kurfürsten und auch ein politisch sehr einflussreicher Mann. Im Auftrage des Kurfürsten wird der Edelmetallgehalt der brandenburgischen Münzen verschlechtert, so dass diese Münzen in den Nachbargebieten nicht mehr akzeptiert werden.
2./3. Januar 1571: Nach dem plötzlichen Tod des Kurfürsten im Köpenicker Schloss werden alle Günstlinge, Mätressen und auch Lippold von dem neuen Kurfürsten Johann Georg verhaftet. In Berlin kommt es zu Pogromen, jüdische Häuser werden geplündert, die Synagoge zerstört und Schuldscheine christlicher Gläubiger vernichtet. In einer langen Untersuchung stellt sich heraus, dass Lippold ein gewissenhafter, ehrlicher und treuer Mitarbeiter Joachim gewesen war: Der Kurfürst schuldete ihm sogar noch Geld.Kurfürst Johann Georg übernahm von seinem am 3. Januar 1571 verstorbenen Vater Joachim II. Schulden in Höhe von 2,5 Millionen Gulden.
1573: In der Folge wird Lippold Zauberei vorgeworfen: er wird gefoltert und nach erpressten Geständnissen zum Tode verurteilt. Auf dem Neuen Markt zu Berlin (vgl. Karte Nr. 9) wird er 1573 grausam hingerichtet, ein klarer Justizmord! Darüber hinaus ordnet der Kurfürst die Vertreibung aller Juden aus der Mark Brandenburg an, „auf ewige Zeiten“. Für die Ausweisung mussten die Juden noch Geld bezahlen, so genannte „Abzugsgelder". In der Folge waren die Mark und Berlin "judenfrei": Die zweite Zerstörung der Jüdischen Gemeinde in Berlin.
1640 bis 1688: In der langen Regierungszeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. (des „Großen Kurfürsten“) lebte anfangs nur ein „Hofjude“ Israel Aaron, in Berlin – Cölln: seine Aufgabe war der Import von Waren und Geräten für Armee und Hof, die nicht in Brandenburg hergestellt worden.
26. Januar 1665: erneuter Schutzbrief des „Großen Kurfürsten“ für Israel Aaron; es wird darin betont, dass er Freizügigkeit genieße und nur der kurfürstlichen Jurisdiktion unterstehe.
19. Mai 1671: Kurfürst Friedrich Wilhelm I. erlässt ein Edikt, nachdem sich 50 jüdische Familien aus Wien (wo sie vertrieben worden waren) für 20 Jahre in Berlin niederlassen durften. Ihre Ansiedlung sollte im Rahmen der merkantilistischen Politik Handel und Wandel in Berlin verändern. Die Familien wohnten anfangs im alten jüdischen Hof an der Königstraße, in der Nähe der heutigen Jüdenstraße (vgl. Karte Nr. 11). Die jüdischen Einwanderer aus Wien beschäftigten sich unter anderem mit dem Kopieren der abgelegten Kleider und Uniformen des Hofes. Aus dieser Wurzel entwickelten sich die ersten Konfektionshäuser am Hausvogteiplatz, die bis 1933 berühmt waren.
12. September 1671: Erteilung eines kurfürstlichen Privilegiums an Israel Aaron und seine Familie: er erhält das Recht, in Berlin, Cölln oder Friedrichswerder ein Haus zu kaufen und wird von der Einquartierung befreit. Er und seine Familie werden von der Zahlung des Leibzolls befreit, müssen aber ein Schutzgeld von jährlich 8 Reichsthalern zahlen.
1672: Ankauf des Geländes in der Großen Hamburger Straße, wo ein jüdischer Friedhof (vgl. Karte Nr. 3) eingerichtet wird; er wird bis 1827 benutzt. Auf dem nur ca. 0,59 ha großen Gelände werden in den ca. 150 Jahren etwa 12.000 Menschen beerdigt, unter anderem auch Moses Mendelssohn und Veitel Heine Ephraim.
Ende des 17. Jhdts: Im Gebiet nordöstlich der Spandauer Vorstadt befinden Ställe und Scheunen von Berliner Ackerbürgern, daher entstand der Name Scheunenviertel. Denn schon 1670 hatte Kurfürst Friedrich Wilhelm aus Brandschutzgründen Scheunen innerhalb der Stadt verboten; um 1672 ordnete er den Bau von 27 Scheunen nördlich der damaligen barocken Festungsmauer an.
1711: Der preußische König Friedrich I. lässt – von zwei jüdischen Renegaten veranlasst – die damals berühmte judenfeindliche Schmähschrift von Johann Andreä Eisenmenge „Entdecktes Judentum oder gründliches Bericht, welcher Gestalt die verstockten Juden die Hochheilige Dreyeinigkeit … verunehren“ in Königsberg neu auflegen. Eisenmenger (1654 – 1704), Professor für die Hebräische Sprache in Heidelberg, gilt als ein Wegbereiter des modernen Antisemitismus.
1712: Die jüdische Gemeinde tritt einen Teil ihres Begräbnisplatzes zum Bau der Sophienkirche und des (christlichen) Sophienkirche aufs ab. Die „Kirchgasse“, der später Sophienstraße genannte Straßenzug, dient als „Zubringer“ zur Sophienkirche. Auf dem Friedhof der Sophienkirche liegen unter anderem die Gräber des bedeutenden Historikers Leopold von Ranke (1795-1886), des Maurermeisters und Komponisten Karl Friedrich Zelter und der Dichterin Anna Louisa Karsch („die Karschin“, 1722-1791).
1714: Am jüdischen Neujahrstag 1714 (1. Tischri 5475 ≙ 10. September 1714, nach dem im Jahre 1700 in Preußen eingeführten Gregorianischen Kalender) wird eine erste neue Synagoge der Berliner jüdischen Gemeinde in der Heidereutergasse eingeweiht. Im 2. Weltkrieg wird diese Synagoge von Bomben zerstört; heute befindet sich dort ein Parkplatz; vgl. Karte Nr. 12).
1730: König Friedrich Wilhelm I. (der „Soldatenkönig“) erlässt unter dem Druck der Zünfte ein Reglement, das jüdischen Händlern das Hausieren in Stadt und Land verbietet. Sie dürfen nur Jahrmärkte und Messen besuchen.
1737: König Friedrich Wilhelm I. befiehlt allen Berliner Juden ohne eigenes Haus ins Scheunenviertel zu ziehen. Zudem führte die Regelung, dass Juden damals nur durch das Rosenthaler Tor Berlin betreten durften, dazu, dass nahebei ein Viertel mit starker jüdischer Bevölkerung entstand. Sie fand dort auch die Synagoge Heidereutergasse und den Jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße.
Oktober 1743: Der vierzehnjährige Moses Mendelssohn (er nennt sich noch Moses Dessau) kommt von Dessau nach Berlin. Der jüdische „Thor-Steher“ am Rosenthaler Tor sollte – von der jüdischen Gemeinde beauftragt – „… darauf achten, dass keine jüdischen Hungerleider oder Streuner in die Stadt einwandern“ (Geier, S. 166, a.a.O.). Er fragt den jungen Mendelssohn, was er in Berlin wolle. Der antwortet: „Lernen!“ Und wohin? „Zu Rabbi Fraenkel!“ (zit. n. Geier, S. 174, a.a.O.). Aber der Tor-Steher lässt das ärmliche, halb verhungerte, mittellose Kind mit einem Schlachtviehtransport passieren. In dem Wachjournal heißt es: „Heute passierten das Rosenthaler Tor sechs Ochsen, sieben Schweine, ein Jude“ (zit. n. Geier, S. 166, a.a.O.).
1747: Der jüdische Mediziner und Naturforscher Marcus Elieser Bloch (1723 – 1799) siedelt sich nach seiner Promotion an der Viadrina als praktizierender Arzt in Berlin an. Neben seiner Praxis betreibt er wissenschaftliche Studien zur Anatomie, v.a. als bedeutender Ichthyologe („Allgemeine Naturgeschichte der Fische“, 12 Bde. 1782 – 1795).
1747/48: Christian Fürchtegott Gellert (1715-69), Professor in Leipzig und damals der – v.a. durch die Fabeln - wahrscheinlich populärste deutsche Dichter veröffentlicht seinen Roman „Leben der Schwedischen Gräfinn von G**“ (a.a.O.). Der Roman wird von der Gräfin selbst erzählt, mit vielen Briefeinlagen; erzählt wird eine abenteuerliche, zuweilen konstruiert erscheinende Geschichte von Liebe, Tugend, Gottvertrauen, Intrigen, Verlangen, Verhängnis, Verbannung und Wiedersehen zwischen Livland, Sibirien und Holland, „… ein streckenweise widerwärtiges Gemisch von Lüsternheit und Tugendhaftigkeit“ (Salzer/Turk, Bd. II. S. 197, a.a.O.).
Besonders interessant ist in dem Roman die Figur des „polnischen Juden“, der von dem Grafen vor dem Erfrierungen Tod gerettet wird und sich als ehrlich, fromm, menschenliebend, gutherzig und hilfsbereit erweist
(vgl. Landau, a.a.O.). Der wohlhabende jüdische Kaufmann, der „Jude“ (er bleibt bei Gellert immer wieder namenlos, alle Juden in dem Roman werden nur als „Jude“ tituliert!) wird als positiver Held gezeichnet.
Gellert charakterisiert den Juden: „Der rechtschaffener Mann! Vielleicht würden viele von diesem Volke beßre Herzen haben, wenn wir sie nicht durch Verachtung und listige Gewalttäthigkeiten noch mehr niederträchtig und betrügerisch in ihren Handlungen machten, und sie nicht oft durch unsere Aufführung nötigten, unserer Religion zu hassen“ (Gellert S. 304, a. a. O.).Vorher gab es in der deutschen Literatur keine vorurteilsfreie Darstellung von Juden, Gellerts „polnischer Jude“ ist der erste „edle Jude“ in der deutschen Literatur.
Ob Moses Mendelssohn den Roman Gellerts kannte, ist nicht sicher (vgl. Knobloch, 1985, S. 57, a.a.O.).
1750: In Preußen tritt das „Revidierte General-Privilegium und Reglement für die Judenschaft im Königreich Preußen“ in Kraft und bleibt es bis zum Emanzipationsedikt von 1812. Je nach ökonomischer Lage sind die Juden „privilegiert“ oder minderen Rechts. Moses Mendelssohn gelingt – nun einundzwanzigjährig – aus der siebenjährigen Illegalität in die unterste Kategorie aufzusteigen: Als Hauslehrer bei einer wohlhabenden jüdischen Familie in Berlin gehört er nun als „befristet geduldetes Dienstpersonal“ zum Haushalt eines „privilegierten“ Juden (vgl. Geier, S. 179, a.a.O.). Falls allerdings ein jüdischer Bediensteter entlassen wird, „… so waren die Judenältesten verpflichtet, der Polizei sofortige Anzeige zu erstatten, damit sie die Entlassenen aus Stadt und Land vertreibe“ (Mehring, S. 295, a.a.O.).
1754: Angeblich beim Schachspiel lernte Mendelssohn den gleichaltrigen Lessing kennen und schätzen, der ihn bei der Publikation seiner ersten, anonym erscheinenden philosophischen Schriften unterstützt. Lessing vermittelt ihm die Bekanntschaft des Schriftstellers und Verlegers Friedrich Nicolai (1733- 1811) [13] , der ihn als Mitarbeiter für seine einflussreiche Zeitschrift „Briefe, die Neueste Litteratur betreffend“ gewinnt. Zusammen mit Lessing und Nicolai, dem Vorsitzenden, gehört Mendelssohn dem Montagsclub der Berliner Aufklärung an.
Lessings bereits 1749 verfasste Komödie „Die Juden“ wird in seinen „Gesammelten Schriften“ publiziert. In dem Lustspiel muss sich ein kluger, hilfsbereiter und höflicher Jude gegen eine ihm feindliche (christliche) Gesellschaft und allerlei Schurken behaupten.
Dagegen wendet sich der damals berühmteste deutsche Orientalist, Hebräist (und Theologe) Johann David Michaelis (1717-1791) und behauptet, dass sich unter den Juden, da sie durch ihre Händlertätigkeit zum Betrug neigten – kein so „edler Charakter“ befinden könne (vgl. Geier, S. 180, a.a.O.).
Moses Mendelssohn antwortete Michaelis in einem anonymen, deutsch geschriebenen Brief an Aaron Solomon Gumperz (1723 – 1769), damals praktizierender Arzt in Berlin; Lessing nahm den Brief in seine „Theatralische Bibliothek“ auf: Mendelssohn führte in dem Brief u.a. aus: „Ist es nicht genug, dass wir den bittersten Haß der Christen auf so manche grausame Art empfinden müssen; sollen auch diese Ungerechtigkeiten wider uns durch Verleumdungen gerechtfertigt werden? Man fahre fort uns zu unterdrücken, Man lasse uns beständig mitten unter freyen und glückseligen Bürgern eingeschränkt leben, ja man setze uns ferner dem Spotte und der Verachtung aller Welt aus; nur die Tugend, den eintzigen Trost bedrängten Seelen, die einzige Zuflucht der verlassenen, suche man uns nicht gänzlich abzusprechen“ (Mendelssohn, zitiert nach Lessing, S. 163, a.a.O.). Ein Beobachter führte Mendelssohn weiter aus, dem die Verachtung Juden gegenüber unbekannt wäre, würde zu dem Lustspiel anmerken: „die guten Leute… Haben doch endlich die große Entdeckung gemacht, dass Juden auch Menschen sind. So menschlich denkt ein Gemüth, das von Vorurtheilen gereinigt ist“ (Mendelssohn, zitiert nach Lessing, S. 164, a.a.O.).
Januar 1756: Im Verlag von Christian Friedrich Voß zu Berlin erscheint „Johann Jacob Rousseaus Bürgers zu Genf Abhandlung von dem Ursprunge der Ungleichheit unter den Menschen, und worauf sie sich gründe: ins Deutsche übersetzt und mit einem Briefe Voltairens an den Verfasser vermehrt“; die Übersetzung stammt von Moses Mendelssohn, aber sein Name wird nicht genannt; mit dem Menschenbild Rousseaus stimmte Mendelssohn nicht überein.
1756-1763. Während des Siebenjährigen Krieges beauftragte der preußische König Friedrich II. Veitel Heine Ephraim mit der Fortführung der sächsischen Münzen. Sehr wahrscheinlich im Auftrage des Königs und zu Gunsten der preußischen Kriegskasse wurden dort Münzfälschungen durchgeführt. Das Besatzungsgeld („Ephraimiten“) hatte einen erheblichen leichteren Münzfuß und durfte nicht in Preußen in Umlauf gebracht werden.
12. Januar 1761: Friedrich II. hebt die vom preußischen Generaldirektorium (der obersten Verwaltungsbehörde) erteilten Aufenthaltsgenehmigungen für neue jüdische Einwanderer wieder auf und lässt sie ausweisen: sie waren nìcht wohlhabend genug. Generell ließ er - realpolitisch - die armen „Betteljuden" vertreiben und privilegierte reiche Juden, nutzte deren Finanzkraft und internationale Verbindungen.
1762-66: Der Berliner Hofjuwelier und Münzunternehmer („Münzjude“) Veitel Heine Ephraim (1703-1775) lässt sein Haus an der Ecke Poststraße und Mühlendamm prunkvoll umbauen. Mit seiner prachtvollen Rokoko-Fassade galt das „Ephraim-Palais“ als das schönste Privathaus Berlins.
26. März 1762: Mendelssohn schreibt seiner Braut Fromet Gugenheim in Hamburg nach langem Hin und Her: „Gestern ist unser Niederlassungsrecht mit Gottes Hilfe akkordiert worden. Nunmehr sind Sie so gut wie Herr Moses Wessely [14] ein preußischer Untertan und müssen die preußische Partei ergreifen. Sie werden also auf gut preußisch alles glauben, was zu unserem Vorteil ist. Die Russen, die Türken, die Amerikaner stehen uns alle zu Dienst und warten nur auf unsern Wink. Unsre Münze wird noch besser als Banko, die ganze Welt wird Sicherheit in Berlin suchen, und unsre Börse wird berühmt sein vom Schloßplatz bis an unser Haus. Dieses alles müssen Sie glauben, denn - Sie haben Niederlassungsrecht in Berlin" (Mendelssohn, zit. n. Badt-Strauss, a.a.O.). Dieses aber war für die Gründung eines jüdischen Hausstandes im Berlin des 18. Jahrhunderts unerlässliche Vorbedingung.
seit 1762: Moses Mendelssohn (1729 - 1786) wohnt bis zu seinem Tode in dem Haus Spandauer Straße 68. Mendelssohn wird der „große Initiator der jüdischen Aufklärung (Haskala)“ (vgl. Geier, S. 167, a.a.O.).
1763: Nach mehreren erfolglosen Bittschriften und Interventionen durch den Marquis d’Argens (1703 – 1771) [15] beim König erhält Moses Mendelssohn einen Schutzbrief, der ihn vor willkürlicher Ausweisung schützt. Zuvor war er noch immer ein rechtloser Jude mit beschränkter Aufenthaltserlaubnis in Berlin. Der Schutzbrief gilt jedoch nicht für seine Frau und die Kinder, die zu diesem Recht erst nach Moses Tod 1786 gelangen.
Der junge schweizer Theologe Johann Caspar Lavater (1741 – 1801) besucht auf seiner Bildungsreise im Jahr 1763 in Berlin auch Moses Mendelssohn. Heinz Knobloch fasste zusammen: „Lavater war dermaßen von Mendelssohn beeindruckt, dass er sich in seiner Bekehrungseinfalt nicht vorstellen konnte, wie ein so hervorragender Mensch Jude bleiben könne“ (Knobloch, 1985, S. 209, a.a.O.).
1767: Im Verlag von Friedrich Nicolai erscheint Moses Mendelssohns Hauptwerk, „Phaedon, oder über die Unsterblichkeit der Seele in drey Gesprächen“, orientiert an Platos „Phaidon“; Mendelssohn plädierte für eine „vernünftige Religiosität“ und glaubt die Unsterblichkeit der Seele mit rationaler Argumentation beweisen zu können. Die Schrift macht Mendelssohn europaweit berühmt, sie wird mehrfach aufgelegt und in zehn Sprachen übersetzt (vgl. Geier, S. 188, a.a.O.). Mendelssohn wird in der Presse als „deutscher Sokrates“ oder „Locke der Deutschen“ gefeiert (vgl. Geier, S. 194, a.a.O.).
1768: Moses Mendelssohns Arbeitgeber Isaak Bernhard stirbt; Mendelssohn wird Teilhaber der prosperierenden Seidenwarenmanufaktur, die er mit großem ökonomischem Erfolg weiterführt (vgl. Geier, S. 179 & 191, a.a.O.).
nach 1769: Nach Gründung der KPM, deren Qualität anfangs nicht an Meißen heranreichte, mussten jüdische Familien für ihre Kinder jeweils für 300 Taler Berliner Porzellan [16] erwerben, um ihre Zulassung als „Schutzjude" zu erwerben. Für ein Generalprivilegium war der Erwerb von Porzellan im Wert von 500 Talern nötig, für den Hauskauf Porzellan im Wert von 300 Talern.
1770: Beginn des „Lavater-Streites“, in dem Lavater Moses Mendelssohn aufgeforderte, zum Christentum überzutreten.
1771: Mendelssohn wird von der Preußischen Akademie der Wissenschaften zum Mitglied gewählt, wird allerdings durch den „aufgeklärten Philosophenkönig" Friedrich II. nicht bestätigte.
um 1775: Die Berliner Judenschaft zählt an die 400 Familien mit etwa 2000 „Köpfen“ (vgl. Steiner, S. 89, a.a.O.).
November 1777: Moses Mendelssohn unternimmt per Postkutsche eine Reise nach Wolfenbüttel, um – auf dessen Wunsch - seinen erkrankten Freund Lessing zu besuchen (vgl. Steiner, S. 55, a.a.O.).
1778: Eröffnung der von David Friedländer und Isaac Itzig gegründeten, von Moses Mendelssohn mitbegründeten „Jüdischen Freyschule“; erstmals wird Unterricht in deutscher Sprache erteilt. Aus ihr entwickelt sich später die jüdische Knabenschule (vgl. Karte Nr.5). David Friedländer veröffentlichte 1779 ein deutschsprachiges „Lesebuch für Jüdische Kinder“. Die „Freyschule“ wurde nur durch freiwillige Beiträge und Spenden finanziert, oft allerdings sehr knapp.
2. Juni 1779: Der „Berlinische gelehrte Schutzjude Mendelssohn .... bittet alleruntertänigst, das ihm verliehene Schutzprivilegium" gratis auf seine Nachkommen auszuweiten; König Friedrich II. schrieb auf den Rand des Gesuchs: „Vor seine Person wohl gratis, aber nicht vor seine Kinder".
Ende der 1770er Jahre: In Berlin leben ca. 140 000 Menschen, darunter mehr als 32 000 Soldaten und ca. 4250 Juden (vgl. Mehring, S. 292/293, a.a.O.). Franz Mehring urteilte, dass die Juden damals „… eher als finanzielle Melkkuh denn als Menschen behandelt wurden“ (Mehring, S. 294, a.a.O.).
1784: Ein Bericht der „Berlinischen Monatsschrift“ urteilt über die Berliner Juden: „Soviel sieht man offenbar: Juden sind in ihrer ersten Anlage eine kluge, tätige, starke und edle Nation. Denn was sind sie selbst noch nicht itzt, unter dem grausamen politischen Druck von unserer, und dem theologischen von Ihrer eigenen Seite!“ (zit. n. Steiner, S. 90, a.a.O.).
Ende 1785: Im Schloss Friedrichsfelde, damals im Besitz der Herzogin von Kurland, kommt es zu einer denkwürdigen Lesung: Nachmittags liest der Dichter Karl Wilhelm Ramler (1725 – 1798) aus "Nathan der Weise" vor, und Moses Mendelssohn sitzt dabei und hört zu. Badt-Strauss meinte dazu: Würde Lessing den Charakter des Nathan minder schön gezeichnet haben, wenn er nicht in seinem Freunde Mendelssohn das Urbild dazu gekannt hätte (vgl. Badt-Strauss, a.a.O.). Wenige Wochen später starb Moses Mendelssohn.
4. Januar 1786: Tod Moses Mendelsohns; am folgenden Tage wird er auf dem Jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße beerdigt (vgl. Karte Nr. 4).
Johann Erich Biester führt in der „Berlinerischen Monatsschrift“ im März 1786 im Nachruf auf Mendelssohn, „Zum Andenken an Moses Mendelssohn“ neben den literarischen und philosophischen Leistungen Mendelssohns an: „Endlich stehe auch hier das Verdienst: dass er durch seinen untadelhaften Wandel, durch seine hohe Rechtschaffenheit und durch sein eifriges Lehren wichtiger Wahrheiten es dahin brachte, dass man erkannte: auch ein Jude, auch ein Unchrist, könne ein guter Mensch sein, könne uns Christen Religion und Tugend befördern“ (Gedike/Biester, Seite 129, a. a. O.).
Franz Mehring bewunderte, was Mendelssohn für die Emanzipation der Juden tat, „… oder doch zu tun versucht hat, denn die Unduldsamkeit der Juden selbst setzte ihm nicht weniger zu als der friderizianische Despotismus… Er war nicht ein Freier durch und durch wie Lessing, sondern ein frei Gewordener, dem noch bei jedem Schritt die zerbrochene Kette mit verräterischem Klirren nachschleift“ (Mehring, S. 333/334, a.a.O.), - ein angesichts Mendelssohns Lebensweg hartes Urteil!
Um 1800: Der Salon von Henriette Herz (1764-1847): viele der angesehensten und berühmtesten BerlinerInnen besuchen ihren Salon und sind mit ihr befreundet; so z. B. Prinz Louis Ferdinand von Preußen, Schadow, Friedrich Schlegel, Varnhagen von Ense, Schleiermacher oder die Gebrüder Alexander und Wilhelm von Humboldt (beide erhalten ihren ersten Hebräischunterricht von Henriette Herz). Nach dem Tode ihrer strenggläubigen Mutter 1817 konvertiert sie zum Christentum und liegt auf dem Dreifaltigkeitskirchhof begraben. Salons sind wichtige Orte der entstehenden Öffentlichkeit und Stätten der diskursiven Aufklärung.
11. März 1812: Edikt zur Emanzipation der Juden in Preußen; die Juden erhalten das preußische Bürgerrecht, unter der Bedingung, dass sie festes Vor- und Familiennamen annehmen. Das Edikt wird in der Restaurationsphase immer mehr eingeschränkt.
Juni 1822: Per Kabinettsorder wird den Juden die Berechtigung zur Bekleidung höherer Militärstellen abgesprochen.
18. August 1822: Eine weitere Kabinettsorder verbietet Juden die Annahme von akademischen Lehr- und Schulämtern.
1827: Eröffnung des jüdischen Friedhofes in der Schönhauser Allee (bis 1880 in Betrieb).
1831: in der revidierten Städteordnung werden Juden von den wichtigsten kommunalen Ämtern ausgeschlossen, es sei denn, sie ließen sich taufen.
1844: Das erste Altersheim der jüdischen Gemeinde wird in der Großen Hamburger Straße (vgl. Karte, Nr.2) errichtet; der benachbarte ehemalige Jüdische Friedhof wird als Park benutzt.
1847: Die Jüdische Gemeinde erhält den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
18. März 1948: Unter den Märzgefallenen der Revolution in Berlin befand sich (sehr wahrscheinlich) eine überproportional große Zahl von jüdischen Berlinern. Namentlich bekannt ist Levin Weiß (*1819, Student aus Danzig; wohnhaft in der Heidereutergasse 8), der als einer der Führer auf der Barrikade in der Königstraße (der heutigen Rathausstraße) ums Leben kam. Da bei den Gefallenenlisten keine Religionszugehörigkeit aufgeführt wurde, bleibt die genaue Zahl der jüdischen Revolutionsopfer unklar. Eine Auswertung nach den Namen, lässt eine Zahl von 9 bis 11 Gefallenen als wahrscheinlich erscheinen. Das wären ca. 4-5 % aller Märzgefallenen, bei einem Anteil von ca. 2% Juden an der Berliner Bevölkerung im Jahre 1848 (vgl. Toury, S. 56, a.a.O.).
5. Dezember 1848: In der neuen Preußischen Verfassung heißt es: „Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich, Standesvorrechte finden nicht statt, die öffentlichen Ämter sind für alle dazu Befähigten gleich zugänglich“. Im § 11 heißt es ausdrücklich: „der Genuss der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig vom religiösen Bekenntnis und der Teilnahme an irgendeiner Religionsgemeinschaft“. Damit war die formale Emanzipation der Juden in Preußen vollendet.
1862: Gründung des Krankenhauses der Jüdischen Gemeinde in der Auguststraße 14/15 (vgl. Karte Nr. …); Es war bis 1914 in Betrieb, danach beherbergte das Gebäude verschiedene jüdische Fürsorgeeinrichtungen.
1863: Zwischen dem ehemaligen Friedhof in der Großen Hamburger Straße und der Sophien-Kirchgemeinde wird eine Schule errichtet, eine Knabenschule; die erste jüdische „Freyschule“, von Moses Mendelssohn mitbegründet, zieht hier ein.
5. September 1866- 25. Elul 5626::Einweihung der prächtigen Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße (vgl. Karte Nr. 7; Abb. s.u.), zum jüdischen Neujahrsfest 1866, nach mehr als siebenjähriger Bauzeit und Kosten von 750 000 Talern. Die Entwürfe für die Synagoge fertigte Eduard Knoblauch (1801-1865), den Bau leitete Friedrich August Stüler (1800-1865). Der Bau wurde in einem damals modischen orientalisierenden Stil errichtet.
In der Neuen Synagoge wird ein reformierter Kultus praktiziert, der
schwere Konflikte innerhalb der Berliner Judenheit auslöst: der hebräische Gottesdienst wird von einer Orgel und einem gemischten Chor begleitet. Einige Gebete werden in der deutschen
Landessprache gesprochen.
Die hebräische Eingangsschrift an der Neuen Synagoge ( „Pitchu sch’arim w-jago goi zadik schomer emunim“ ≙ “Öffnet die Tore, und es kommt das gerechte Volk, dass die Treue bewahrt“, Jesaja, 26,2) wurde von den Gegnern der Kultusreform anders gelesen und interpretiert: Sie ließen hinter dem Begriff „goi“ (≙ Nichtjude) eine Zäsur, so dass der Text nun ergab: “Öffnet die Tore und es kommt der Nichtjude, der Gerechte wahrt die Treue“.Die Neue Synagoge war mit ca. 3200 Sitzplätzen die größte Synagoge Deutschlands.
1869: Eine konservative Gruppe des Berliner Judentums schließt sich aus Protest gegen die liberale Gemeinde zur Separatgemeinde “Adass Jisroel“ - Israelitische Synagogen-Gemeinde - zusammen. Das Rabbinerseminar dieser orthodoxen Gemeinde, zuerst in der Gipsstraße, später in der Artilleriestraße 31 (heute Tucholskystraße 40, wo sie sich noch heute befindet; vgl. Karte Nr. ….) war eine Anlaufstelle für die frommen jüdischen Emigranten aus Osteuropa.
1870: Der deutsche reformorientierte Rabbiner und jüdische Gelehrte Abraham Geiger (*.1810 in Frankfurt am Main, gest. 1874 in Berlin) gehört (neben Ludwig Philippson und Salomon Neumann) zu den Gründern der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums [1] in Berlin. Die Hochschule soll der Erhaltung, Fortbildung und Verbreitung der Wissenschaft des Judentums dienen. Später dient die Hochschule aber v.a. der wissenschaftlichen Ausbildung von Rabbinern und jüdischen Religionslehrern.
An der Hochschule lehrte Geiger von 1872 bis zu seinem Tod 1874.
[1] Von 1883 bis 1922 sowie von 1933 bis 1942 trägt die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums den Namen „Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums“.
27. Juni 1870: In einem Brief an den deutsch-jüdischen Mediziner und Sozialdemokraten Ludwig Kugelmann (1820 – 1902) bezeichnet Karl Marx Moses Mendelssohn den „…Urtyp eines Seichbeutels“ (Marx/Engels, S. 686, a.a.O.). Im rheinischen Regiolekt ist ein „Seichbeutel“ eine „zweifelhafte Person“, ein „fader Schwätzer“. Jürgen Kuczynski meinte dazu, Marx habe damit weniger den Aufklärer Mendelssohn gemeint, sondern dessen politischen „banalsten Reformismus“ (Kuczynski, zit. n. Hartung, S. 37, a.a.O.).
22. Oktober 1873 - 1. Marcheschwan 5633: Eröffnung des orthodoxen Rabbinerseminars in der Berliner Gipsstraße 12a durch Rabbiner Dr. Esriel Hildesheimer; daher wird es bis heute auch als Hildesheimer'sches Rabbinerseminar bezeichnet. Es war die wichtigste Einrichtung zur Ausbildung orthodoxer Rabbiner im deutschsprachigen Raum und hatte von 1873 bis zur zwangsweisen Schließung durch die Nationalsozialisten 1938 insgesamt ca. 600 Studenten aus ganz Europa.
1874 -1890: Adolf Stoecker (1835 -1909) ist vierter Dom- und Hofprediger am Berliner Dom (dem von Karl Friedrich Schinkel umgebauten Vorgängerbau des heutigen Doms, vgl. Karte, Nr. 15). Der einflussreiche Antisemit versuchte den Klassenkampf durch einen Rassenkampf zu ersetzen. 1878 gründet er die "Christlich - Soziale Arbeiterpartei": die antisemitische, antisozialdemokratische Partei bekämpfte u.a. den "jüdischen Geist' an der Börse und im Zeitungswesen.
1880: Eröffnung des Friedhofs in Weißensee; in Berlin leben nach der amtlichen Statistik 2954 „ nicht-deutsche Israeliten“, v. a. Juden, die vor den osteuropäischen Pogromen aus Russland und dem österreichisch bzw. russisch beherrschten Polen geflüchtet waren. Der Begriff „Ostjude“ kommt auf.
Viele siedeln sich im historischen Scheunenviertel an, das eigentlich das Gebiet westlich des Alexanderplatzes, bis zum Rosenthaler Platz und südlich bis zur Stadtbahn umfasst. Es ist ein Viertel armer Leute, auch Bettler, Obdachlose, Prostituierte und auch Kriminelle leben hier. Das Scheunenviertel gilt geradezu als „Schlupfwinkel des Verbrechertums“ war verrufen. Zentrum des jüdischen Lebens war bis zum Ende der Zwanzigerjahre die Grenadierstraße (heute: Almstadtstraße). Hier fand der frommeimmigrierte Jude alles, was er für sein Leben brauchte: koschere Speisestuben, koschere Schlächtereien und Geschäfte, eine ganze Fülle von wurde „Schtibeln“, Gebetsräumen der verschiedenen konkurrierenden chassidischen Rabbinerschulen.
In diesem Gebiet sind heute kaum noch Spuren der jüdischen Vergangenheit zu finden.
1893: Gründung des „Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“
1904: Die große Synagoge in der Rykestraße / Prenzlauer Berg wird eingeweiht
nach 1905: Nach den Verfolgungen im Anschluss an die erste russische Revolution flüchten erneut Juden aus Polen Russland und der Ukraine, wenige jedoch nur nach Deutschland und Berlin (u. a. Alexander Granach).
1906/07: Der aus Galizien stammende Schauspieler Alexander Granach (1890 - 1945) beschreibt nach seiner Ankunft in Berlin das Scheunenviertel 1906/07: … und plötzlich war ich mitten in Berlin in einer Gegend wie Lemberg ... Grenadier-, Dragoner-, Mulackstraße, Ritterstraße, Schendelgasse – da gab es noch kein Bülowplatz keine Volksbühne. Kleine enge, finstere Gässchen mit Obst-und Gemüseständen an den Ecken, Frauen mit bemalten Gesichtern, mit großen Schüsseln in den Händen strichen herum, wie in der Zosina-Wolja-Gasse in Stanislau oder in der Spitalna in Lemberg. Viele Läden, Restaurants, Eier-, Butter-, Milchgeschäfte, Bäckereien mit der Aufschrift „Koscher“. Juden gingen umher, gekleidet wie Galizien, Rumänien und Russland. Die keine Geschäfte hatten, handelten mit Bildern und Möbeln auf Abzahlung. Man ging hausieren mit Tischtüchern, Handtüchern, Hosenträgern, Schnürsenkel, Kragenknöpfen, Strümpfen und Damenwäsche. Andere wieder gingen von Haus zu Haus, alte Kleider kaufen, die dann Großhändler aufkauften und in die alte Heimat lieferten. Die meisten aber in dieser Gegend waren Arbeiter und Arbeiterinnen, die in den Zigarettenfabriken Manoli, Carbaty oder Muratti beschäftigt waren. Da war auch ein reges gesellschaftliches Leben. Die Frommen hatten verschiedene Gebetshäuser, nach ihren Sekten, nach ihren Rabbis benannt. Da gab es Zionisten aller Schattierungen, da gab es Sozialrevolutionäre, Sozialisten, den „Bund“ und Anarchisten. Und es gab auch Theater und Sänger. Im Königscafè in der Münzstraße trat der Komiker Kapanoff auf. Und das Restaurant Löwenthal in der Grenadiertraße, nahe der Münzstraße, hatte eine Bühne und spielte Theater. Da traten kleine Schauspieler und Statisten auf von den guten Theatern in Russland, Rumänien, Galizien und priesen sich mit riesigen Lettern und Klischees auf den Plakaten als berühmter internationale Stars an… Ich bekam Arbeit bei Scholem Grünbaum in der Grenadierstraße (einer jüdischen Bäckerei) und fühlte mich bald zuhause in diesem Berlin“ (Granach, S. 205/206, a.a.O.).
Zum gleichen Zeitraum erfolgt der Abriss des vernachlässigt-desolaten Kerns des Scheunenviertels
1907: Die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums erhält ein eigenes Gebäude in der damaligen Artilleriestraße 14 (heute Tucholskystraße 9 in Berlin-Mitte).
1911/12: Bau der Synagoge in der Pestalozzistraße in Charlottenburg, mit 1400 Plätzen.
1912: Einweihung der Synagoge in der Fasanenstraße
ab 1914: im 1. Weltkrieg werden mehr als 35.000 Juden aus Russland und Polen nach Deutschland zur Arbeit transportiert: in die Rüstungsindustrie aber auch den Ausbau zum Beispiel der Berliner S-Bahn. Zum Teil werden sie zwangsverpflichtet, viele erhalten auch sehr knebelnde Arbeitsverträge.
1916: Das jüdische Volksheim in der Dragonerstraße 22 (heute Max-Beer-Str.) wird eröffnet. Linke jüdische Intellektuelle streben hier für die zum Teil verwahrlosten Kinder armer jüdischer Einwanderer eine Verbindung von Sozialismus und pädagogischer Praxis an, sie versuchen eine Symbiose von Ost und West. Gustav Landauer hielt die Eröffnungsrede, es arbeiten dort u.a. Martin Buber, Gerschom Scholem, Siegfried Lehmann (der Gründer des Volksheims) und Salman Rubaschoff (der spätere Staatspräsident Israels, Salman Schasar, 1889 – 1974). Max Brod war zu Dichterlesungen im Volksheim zu Gast, auch sein Freund Franz Kafka besuchte das sei (seine Braut Felice Bauer studierte dort) und zeigte in seinen Briefen ein großes, wenn auch z. T. kritisches Interesse an dem Heim.
Als erster „ungetaufter Jude“ wird Bernhard Weiß [17] in das preußische Innenministerium berufen, wo er Karriere macht.
nach 1918: nach Gründung der osteuropäischen Nationalstaaten geht eine Welle von Nationalismus und Antisemitismus durch die Regionen; tausende osteuropäische Juden flüchten vor Pogromen und Vertreibungen, auch nach Berlin
In der Auguststraße 14-16, im Hinterhaus entsteht ein Aufnahmeheim für ostjüdische Flüchtlinge. Später wird es zum Kinderheim „Ahawah“(≙ hebr. „Liebe“). 1938 wird es geschlossen, es warten später viele Menschen hier auf ihre Deportation. Ab dem Sommer 1943 gilt die Auguststraße als „judenrein".
1921/22: Bei Stargard in Pommern und in Cottbus werdenden Sammellager zur massenweisen Abschiebung von „Ostjuden“ eingerichtet. Im amtlichen Sprachgebrauch werden sie „Konzentrationslager“ genannt. Erst im Dezember 1923 werden sie endgültig geschlossen, nicht zuletzt wegen der kritischen Reaktionen im Ausland. Nur die SPD und die KPD wenden sich gegen die Massenausweisungen (vgl. Verein Stiftung Scheunenviertel, S. 96, a. a. O.).
1922: Abspaltung der „Deutschvölkischen Freiheitspartei“ von der DNVP. Unter General Ludendorff beteiligt sie sich am Hitler-Putsch im November 1923 in München.
Der „Deutschvölkische Schutz-und Trutzbund“ ist mit 25.000 Mitgliedern der größte deutsche antisemitische Propagandaverein.
5./6. November 1923: Fast zeitgleich mit dem Hitler-Putsch in München kommt es zu einem Pogrom im Scheunenviertel: In die Warteschlangen vor dem Arbeitsamt in der Gormannstraße mischen sich – zum Teil gut gekleidete – völkische Agitatoren mit Flugblättern. U.a. verbreiten sie demagogische Nachrichten über angebliche betrügerische Tauschgeschäfte von jüdischen Händlern mit Arbeitslosen. Daraufhin ziehen tausende von Arbeitslosen – von den antisemitischen Agitatoren angestachelt – durch das Scheunenviertel. Sie rufen unter anderem „Schlagt die Juden tot“, „Zieht die Juden aus“, „Juden nieder“. Jüdische Geschäfte werden demoliert und geplündert, randalierend wird in jüdische Wohnungen eingedrungen. Juden werden überfallen und beraubt, es kommt zu regelrechten Menschenjagden: Juden werden gejagt und ausgezogen.
Am Nachmittag des 5. Novembers 1923 versucht ein spontan organisierte Trupp von 20 Angehörigen des „Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten“ (BjF), bewaffnet mit Gummiknüppeln und Pistolen die jüdische Bevölkerung vor weiteren Gewalttaten zu schützen. Am Bülowplatz (dem heutigen Rosa-Luxemburg-Platz, an der Einmündung der Linienstraße; vgl. Karte Nr. 16) werden sie von antisemitischen Randalierern umringt, bedroht und angegriffen (vgl. Verein Stiftung Scheunenviertel, S. 99, a. a. O.). Die herbeigerufene Polizei greift nicht ein. Erst als einer der von der Menge angegriffenen jüdischen Frontsoldaten in seiner Not seine Pistole zieht und einen der Angreifer erschießt, greift die Polizei ein. Sie verhaftet die Gruppe jüdischer Frontkämpfer: Sie werden in die Polizeiinspektion am Alexanderplatz gebracht. Einige der jüdischen Frontkämpfer werden von Polizisten geschlagen und getreten, dazu rufen Polizisten unter anderem: „Euch Judenjungen werden wir das zeigen“, oder „Aufhängen müsste man die ganze Judenbande“. Spätere Strafverfahren gegen die entsprechenden Polizisten verlaufen im Sande
Tausende jüdische Bewohner des Scheunenviertels flüchten in andere Stadtteile.
Erst als am 6. November starke Polizeikräfte mit Panzerautos, Handgranaten, Karabinern und (erstmals in der Berliner Polizeigeschichte) mit Gummiknüppeln ausgerüstet ins Scheunenviertel einziehen, erbt der Pogrom ab. Die Polizei versucht den politischen Hintergrund des Pogroms zu leugnen.
8. November 1923: Der sozialdemokratische Politiker, Journalist und Reichstagsabgeordneter Arthur Chrispien (1875-1946, in Bern) schreibt im „Vorwärts“: „Die antisemitische Saat ist aufgegangen … Berlin hat seinen Judenpogrom gehabt. Berlin-West geschändet worden. Eine Schmach für ein Volk, das sich zu den zivilisierten zählt“.
1925: In Berlin leben ca. 170.000 Juden, davon ca. 40.000 ohne die deutsche Staatsbürgerschaft, das sind ca. 4 % der Gesamtbevölkerung Berlins. Einige tausend Juden (die Zahl ist umstritten) Leben im Scheunenviertel.
1926: Bernhard Weiß wird Chef der Kripo, 1927 bis 1932 wird er Vizepräsident der Berliner Polizei. In der NS-„ Kampfzeit“ ist er einer der Hauptgegner der faschistischen Presse, vor allem von Josef Goebbels. Vielfach lässt Goebbels Weiß karikierten; er legte ihm den „undeutschen“ Spottnamen „Isidor“ bei.
1929: im Scheunenviertel (um die Dragoner-, Grenadier-, Linien-, Rücker- und Mulackstraße) liegt die Wohndichter fünfmal höher als im Berliner Durchschnitt. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal, weniger als die Hälfte der Wohnungen hier verfügen über eine eigene Toilette.
Der Kindergarten des jüdischen Volksheimes schließt, viele Mitarbeiter tendieren immer stärker zum Zionismus; viele emigrieren nach Palästina.
14. Januar 1930: Eine Gruppe der „Sturmabteilung-Mitte“ der KPD beschließt in der Gaststätte „Bär“ in der Dragonerstraße 48 (heute: Max-Beer-Str.) einem politischen Gegner eine „proletarische Abtreibung“ zu verpassen: in seinem Zimmer in der Großen Frankfurter Straße wird Horst Wessel (seit 1929 der Führer des 34. Trupps der Berliner SA) angeschossen. Er stirbt am 23. Februar 1930 an den Folgen seiner Verletzungen und wird zum „nationalsozialistischen Freiheitshelden“ hochstilisiert.
1. März 1930: Bei der Beerdigung von Horst Wessel kommt es am Bülowplatz (vgl. Karte, Nr. 16) zu gewalttätigen Demonstrationen, wobei der Leichenwagen beinahe umgestürzt wird.
8. August 1931: Bei Auseinandersetzungen während einer kommunistischen Demonstration am Bülowplatz wird der neunzehnjährige Klempner Fritz Auge von Polizeikugeln getötet. Noch in derselben Nacht tauchen anwenden der Berliner Innenstadt Parolen auf, wie: „Für einen erschossenen Arbeiter fallen zwei Schupo Offiziere! Rot-Front nimmt Rache!“
9. August 1931: Die beiden uniformierten Polizeihauptleute Paul Anlauf und Franz Lenck (die im Scheunenviertel unter dem Namen „Schweinebacke“ und „Totenkopf“ bekannt und unbeliebt waren) werden am Bülowplatz vor dem Kino „Babylon“ erschossen: Erich Mielke (damals ein 23 jähriger kommunistischer Arbeiter) wird später beschuldigt, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Sicher ist, dass die Tat von dem militärischen Apparat der KPD veranlasst wurde. Unklar hingegen sind die Motive geblieben, unter Umständen war das Verbrechen nicht nur ein prompte Racheakt. Obwohl das Verhältnis vieler Einwohner des Scheunenviertels zur Polizei recht gespannt war, wurden die kaltblütigen Morde von den meisten Menschen, auch vielen Kommunisten, abgelehnt.
20. Juli 1932: Anlässlich des „Preußenschlages“ von Reichskanzler Franz von Papen wird die Berliner Polizeiführung, auch Bernhard Weiß, abgesetzt und festgenommen.
1933: Eröffnung des Jüdischen Museums im Nachbargebäude der Synagoge Oranienburger Straße.
Der „Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ vertritt ca. die Hälfte der vor 1933 ca. 600.000 deutschen Juden. § 1 der Satzung besagt, dass der Verein den gläubigen Juden in „ der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in der unbelehrbaren Pflege deutscher Gesinnung bestärken…“ wolle.
Die Berliner Jüdische Gemeinde hat ca. 170 000 Mitglieder. 100 000 gelang die Emigration, 55 000 wurden ermordet; mindestens 3000 Selbstmorde soll es allein in Berlin gegeben haben. 5 000 überlebten die Lager und etwa 5 000 sollen es sein, die in der Reichshauptstadt versteckt den Faschismus überlebten.
Die Schule in der Großen Hamburger Straße wird von 470 Jungen besucht. Wenige Jahre später sind es über 1000, auch kommen Mädchen dazu. Der Zuwachs erfolgte allerdings nicht freiwillig, jüdische Kinder werden aus anderen Schulen verdrängt.
1933-1940: Heinrich Stahl (1868-1942; im Ghetto Theresienstadt) ist Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Er war zuvor viele Jahre Direktor der Victoria Versicherung gewesen.
nach dem 30. Januar 1933: Beginn einer großen Emigrationswelle; Bernhard Weiß entkommt den Nazi-Verfolgern mit viel Glück: er fliegt nach England ins Exil, er wird ausgebürgert.
Nach 1933: Im Scheunenviertel erfolgt eine wahre Umbenennungsorgie zu Gunsten des NS-Mythos Horst Wessel: der Bülowplatz wird zu Horst-Wessel-Platz, das Karl-Liebknecht-Haus wird zu Horst-Wessel-Haus, die Weydingerstraße wird zu Horst-Wessel-Straße, die Volksbühne wird zu Horst-Wessel-Theater. Ungefähr eine halbe Million Söhne erhalten in den nächsten Jahren den Vornamen Horst.
1. April 1933: Beginn des Boykotts von Geschäften im Besitz deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und jüdischer Abstammung
1935/36: Bei einer Erweiterung des Mühlendamms wird das Ephraim-Palais abgetragen, die Fassadensteine wurden jedoch aufbewahrt (allerdings im späteren West-Berlin).
Ab 1938: Der Berliner Polizeipräsident Graf Helldorff erpresst von emigrationswilligen Berliner Juden die sogenannte Helldorff-Spende, bevor er ihnen ihren zuvor konfiszierten Reisepass übergeben lässt.
Jüdische Deutsche dürfen nicht mehr als Beamte, Ärzte, Apotheker, Juristen etc. arbeiten.
In der Nazi-Terminologie wird die Unterscheidung „arisch versippter“ in „einfache“ und „privilegierte Mischehen“ üblich, allerdings nicht kodifiziert. Unter einer „privilegierten Mischehe“ wurden Ehen verstanden, bei denen die Frau jüdisch, der Mann nicht jüdisch, oder der Mann jüdisch, die Frauen nicht jüdisch und die Kinder nicht in der jüdischen Gemeinde angehörten. Alle anderen Formen galten als „einfache Mischehen“. „Arische Versippung“ wurde von den Betroffenen lange Zeit als ein gewisser Schutz angesehen.
27./29. Oktober 1938: „Polenaktion“: Verhaftung und Abschiebung von etwa 15.000 Juden aus Osteuropa
Ende November 1938 – 1. September 1939: In diesem Zeitraum wurden in einer internationalen Hilfsaktion, „Kindertransporte“, mehr als 10 000 jüdische Kinder (im Sinne der Nazi-Gesetzgebung) v.a. Kinder aus Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechoslowakei ins Exil, in Zügen und mit Schiffen überwiegend nach Großbritannien gebracht und so gerettet. Die meisten dieser Kinder sahen ihre Eltern nie wieder, vielfach waren sie die einzigen aus ihren Familien, die den Holocaust überlebten.
9./10. November 1938: Staatlich organisierter Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung Deutschlands; in der euphemistisch. „Reichskristallnacht“ genannte Aktion werden fast alle Synagogen Deutschlands verwüstet und niedergebrannt, Geschäfte verwüstet, jüdische Bürger verhaftet, verprügelt und ermordet. 40 der 50 Berliner Synagogen (vgl. Hilker-Siebenhaar, S. 34, a.a.O.) standen in der Nacht in Flammen und wurden zerstört. Nur die Neue Synagoge [18] in der Oranienburgerstraße blieb durch das Eingreifen des „beherzten Reviervorsteher“ Wilhelm Krützfeld erhalten. Krützfeld bewies in der Nacht zum 10. November 1938 lebensgefährliche Zivilcourage und stellte sich mit weiteren Beamten seines Reviers den Brandstiftern entgegen, obwohl er wusste, dass es sich um einen staatlich gelenkten und erwünschten Pogrom handelte.
1. Januar 1939: Alle jüdischen Deutschen müssen amtlich den zusätzlichen Vornamen „Sara“ bzw. „Israel“ annehmen.
Frühjahr 1939: Nach Aufräumungsarbeiten finden in der Neuen Synagoge wieder Gottesdienste statt.
1. September 1939: Beginn des 2. Weltkrieges; seit 1933 haben rund 236.000 Juden Deutschland verlassen. In Berlin leben noch ca. 80 000 jüdische Deutsche
Dezember 1939: Die Adass-Jisroel-Gemeinde wird - wie allen anderen jüdischen Gemeinden in Deutschland - nach zahllosen vorherigen Akten der Verfolgung und Entrechtung von Gestapo zerschlagen und in die von den Nazis gegründete "Reichsvereinigung der Juden in Deutschland" eingegliedert.
19. September 1941: Polizeiverordnung über die vorgeschriebene Kennzeichnung der jüdischen Deutschen („Judenstern“), Angehörige der „privilegierten Mischehen“ brauchen den „Judenstern“ nicht zu tragen. Alle jüdischen Deutschen (ab 14 Jahren) werden zur Zwangsarbeit verpflichtet.
18. Oktober 1941: Der erste Deportationszug verlässt mit 1.013 jüdischen Berlinern den Bahnhof Grunewald, Es ist der Beginn der systematischen Deportationen der Juden aus Berlin. Bis 1945 wurden über 50.000 Juden vom Bahnhof Grunewald (sowie vom Güterbahnhof Moabit und vom Anhalter Bahnhof) deportiert. Allein nach Auschwitz fahren etwa 35 Züge mit 17.000 Juden vom Bahnhof Grunewald ab, die meisten von dem Gleis 17..
Allein im Fort 9 in Kaunas/Litauen werden ca. 1000 Berliner Juden ermordet. Heute erinnert dort eine Gedenktafel an dieses Verbrechen (vgl, Abbn. unten).
24. Oktober 1941: Ein Dekret des Reichssicherheitshauptamts bestimmt als Strafe: Wer „freundschaftliche Beziehungen zu Juden" pflegt, sollte bis zu drei Monate in ein KZ eingewiesen werden. So nehmen Menschen, die Juden helfen, ein riskantes Wagnis auf sich - und ihre Angehörigen.
Im besetzten Osteuropa muss jeder mit Erschießung rechnen, der Juden hilft. Im „Altreich“ lässt sich zwar kein Todesurteil für einen nichtjüdischen Helfer von Juden feststellen. Dies ist jedoch ein fragwürdiger, keineswegs endgültiger Befund: Die Gerichtsakten aus der Zeit des Nationalsozialismus verschleiern oft die Fälle der Helfer, die vor Gericht standen,. Die Helfer werden vielfach wegen „Rassenschande“, Urkundenfälschung, Devisenvergehen o.ä. verurteilt.
seit 1941: Zwischen 5000 und 15 000 deutsche Juden verstecken sich im Untergrund und entziehen sich der Deportation und der Ermordung. Etwa die Hälfte von ihnen – nach Schätzungen - allein in Berlin, wo das Untertauchen, vor allem seit dem eskalierenden Bombenkrieg, relativ leichter war. Die Helfer boten Unterschlupf, besorgten Papier und retteten vom Tod, bedrohten Juden. Durch ihr Handeln widerlegen sie die These, dass es nur Mitläufer und Mittäter gab.
Der Berliner Volksmund nannte die versteckt lebenden Juden, „U-Boote"; sie mussten ohne Lebensmittelmarken und ohne dauerhafte Bleibe, ohne Ausweis und ärztliche Versorgung. leben, immer auf der Flucht vor SS und Gestapo, vor Denunzianten und Blockwarten. Es gibt Fälle von untergetauchten jüdischen Deutschen (z.B. Konrad Latte), die bis zu 50 Mal ihren Unterschlupf in der zerbombten, zerstörten Großstadt wechseln mussten.
ab 1941: Otto Weidt (1883 – 1947) war ein Kleinunternehmer, der im 2. Weltkrieg seine betrieblichen und privaten Möglichkeiten unter Lebensgefahr zur Rettung von Juden benutzte. Der Betrieb in der Rosenthaler Straße 39 stellte Bürsten und Besen her, da er u.a. für die Wehrmacht arbeitete, galt er als „wehrwichtig“. Die meisten der ca. 30 Arbeiter, die Weidt beschäftigte, waren blinde oder taubstumme Juden, die seit 1941 zur Zwangsarbeit verpflichtet waren. U.a. waren auch Alice Licht und die Schriftstellerin Inge Deutschkron in der Werkstatt von Otto Weidt beschäftigt. In ihrem Buch „Ich trug den gelben Stern“ berichtete sie von dieser Zeit. Einige Weidts Angestellten konnten sich mit seiner Hilfe retten.
20. Januar 1942; Wannseekonferenz zur „Endlösung der Judenfrage“; Beginn der Deportationen nach Auschwitz und Theresienstadt
1942: Alle jüdischen Schulen werden verboten- auch das Haus in der Großen Hamburger Straße wird zum Ausgangsort für Deportationen.
In dem ehemaligen jüdischen Altersheim in der Großen Hamburger Straße richtet die Gestapo ein Sammellager ein, in denen zehntausende jüdischer Deutscher zur Deportation zusammen getrieben wurden. Der angrenzende ehemalige Friedhof mit ca. 2000 alten Grabsteinen wird in den Lagerkomplex eingezogen und mit Wachtürmen etc. gegen Fluchtversuche gesichert.
19. Juli 1942: Schließung des Lehrinstituts in der Artilleriestraße und Beschlagnahme des wertvollen Inventars. Der letzte verbliebene Lehrer und Rabbiner Leo Baeck wird 1943 zusammen mit den restlichen Studenten ins KZ Theresienstadt deportiert.
Dezember 1942: Alois Brunner [19], der „Schlächter von Wien“, kommt nach Berlin, um die „Reichshauptstadt“, sowie Wien zuvor, „judenrein“ zu machen. Als Leiter von SS-Sonderkommandos war Brunner mitverantwortlich für die Deportation von mehr als 100.000 Juden aus Wien, von 56.000 Juden aus Berlin, tausenden aus Griechenland, Frankreich und der Slowakei in die Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis (vgl. Brunner/Seltmann, a.a.O.; die Co-Autorin ist eine Großnichte von Alois Brunner).
1943: Auflösung der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland; die dritte Zerstörung der Jüdischen Gemeinde Berlin.
seit dem 27./28. Februar 1943: Nach der sog. „Fabrikaktion" brachte die Gestapo alle nach faschistischer Terminologie „arisch versippten" jüdischen Berliner in das Verwaltungsgebäude der Jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße (später bombardiert und zerstört, vgl. Karte Nr. 12). Es handelte sich um ca. 1500 Männer, Frauen und Kinder. Daraufhin demonstrieren täglich ca. eine Woche lang mehrere hundert Ehefrauen und Freunde mit Sprechchören vor dem Gebäude. Unter den demonstrierenden befanden Wehrmachtsangehörige in Uniform. Schließlich erreichten die Protestierenden am 6. März 1943 die Freilassung ihrer Angehörigen. Diese Demonstrationen waren die einzige öffentliche kollektive Protestaktion gegen die Deportationen, die jemals im faschistischen Deutschland stattfanden.
10. Juni 1943: Auflösung der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland.
22. November 1943: die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße wird bei einem britischen Bombenangriff getroffen und brennt aus. Die Reste des Hauptraums werden Ende der fünfziger Jahre abgetragen.
1943- 1945: In diesem Zeitraum hielt sich der achtzehnjährige deutsch-jüdische getaufte Musiker Konrad Latte (1922 – 2005) in Berlin und anderen Städten versteckt. Vorher arbeitete er als Organist in der St.-Annen-Kirche in Dahlem. Etwa fünfzig Menschen halfen ihm und seiner Familie beim Untertauchen. Unter ihnen befanden sich auch Prominente wie der Komponist Gottfried von Einem, Pfarrer Harald Poelchau, der Pianist Edwin Fischer, der Dirigent Leo Borchard, die Journalistin Ruth Andreas-Friedrich, die Schauspielerin Ursula Meißner und Anne-Lise Harich. Latte musste sich nicht nur alle paar Wochen oder Tage eine neue Unterkunft suchen – eine wahre Flucht-Odyssee - , zudem musste er – permanent gefährdet - beinahe täglich weite Strecken in Berlin zurücklegen, um als Hilfsorganist an entfernten Kirchen zu arbeiten, sogar im Auftrage des Propagandaministerium. Auch suchte und fand Konrad Latte in dieser Zeit Lehrer, die ihn weiter ausbildeten.
Die Eltern Lattes starben in Auschwitz. Nach dem Krieg arbeitete Konrad Latte als Musiker in Cottbus (1949–52) und in Bautzen (1952/53). 1953 gründete er das Berliner Barock-Orchester, das er bis 1997 leitete. Zuletzt lebte er mit seiner Ehefrau Ellen in Berlin-Wannsee.
Von Peter Schneider erschien im März 2001 „’Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen...’. Wie ein jüdischer Musiker die Nazi-Jahre überlebte“(a.a.O.). Konrad Latte hat für das Buch Peter Schneider sein Leben erzählt, das Buch eine Biographie Lattes, aber auch ein historisches Dokument, ein Bericht zu Terror und Zivilcourage.
Ende März 1945: Die letzten Deportationszüge verlassen Berlin nach Sachsenhausen und Ravensbrück.
April / Mai 1945: Auf dem – von den Nazis zerstörten – alten jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße werden zahlreiche Soldaten und Zivilisten in Massengräbern beerdigt (vgl. Gedenktafel), um Seuchen vorzubeugen: dieser jüdische Friedhof ist daher einer der wenigen, auf dem auch Nicht–Juden beerdigt wurden.
1945: Befreiung Berlins durch die Rote Armee; von über 160.000 Berliner „Glaubensjuden“ wurde wurden 55.000 ermordet, 7.000 starben durch Selbsttötung, 90.000 war die Emigration gelungen, nur 8.000 Berliner Juden erlebten die Befreiung. 4700 überlebten in so genannten Mischehen, wurde 1400 im Untergrund, 1900 kehrten aus den Konzentrationslagern zurück.
Auf dem Gelände des ehemaligen Jüdischen Friedhofs in der großen Hamburger Straße (vgl. Karte Nr. 3) werden zahllose Soldaten und Zivilisten, die in den letzten Kriegstagen getötet worden, in Massengräbern beigesetzt. Später wird dazu ein Gedenkstein errichtet.
nach 1945: Vor allem Besatzungssoldaten und -organen gegenüber gibt es nun viele Deutsche, die Juden gegenüber immer Sympathien gehegt hätten (’Mein bester Freund war ein Jude’) oder Juden beschützt oder geholfen haben wollten. Gottfried Reinhardt (der Sohn Max Reinhardts) berichtet 1945 als amerikanischer Soldat über das angebliche Heldentum jener Deutschen, die ihm nun ihre tiefe Betroffenheit über die „Endlösung" versicherten und vielen jüdischen Freunden geholfen haben wollten. Reinhardt provozierte sie mit dem Satz: „Offensichtlich gab es zu viele Juden hier!" – „Zu viele Juden? Wie meinen Sie denn das, Herr Reinhardt?" – „Jeder Deutsche, den ich treffe, hat zwei Juden gerettet. Die Deutschen waren ein Volk von 80 Millionen Menschen. Wenn jeder zwei Juden gerettet hat, muss es etwa 160 Millionen Juden gegeben haben. Und Sie werden mir zugeben müssen: Das ist einfach zu viel!" (vgl. Schneider, a.a.O.).
Es gab aber auch die „stillen Helden“, wie Otto Weidt oder Wilhelm Krützfeld. Allerdings „… bedroht das Beispiel dieser ‚anderen Deutschen‘ das Selbstbild der Mitläufer viel nachhaltiger als die Geschichte der Widerstandskämpfer und Attentäter... Heldentum kann man nicht verlangen. Einem Verfolgten und Geächteten ein Stück Brot zustecken, ihn bei sich übernachten lassen, ihm eine nächste Unterkunft zu besorgen, dazu brauchte es Anstand, List und Courage, aber nicht gleich Todesbereitschaft“ (Peter Schneider, a.a.O.).
Festzuhalten bleibt: Die Deutschen, die z.B. Konrad Latte halfen, zeigten damit auch, dass es im NS-Deutschland nicht nur die Wahl zwischen willfährigem Gehorsam, Wegschauen und todesmutigem Widerstand gab. Peter Schneider: „Offensichtlich konnte man doch etwas tun, ohne gleich sein Leben zu riskieren.
1946:Wiederanerkennung der Jüdischen Gemeinde Berlin als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ihren Sitz hatte die Gemeinde in der Oranienburger Straße, neben der Ruine der Neuen Synagoge.
1947: Die Jüdische Gemeinde Berlin verzeichnet 1379 Mitglieder; 1933 wohnten noch ca. 170 000 Juden in der Hauptstadt.
1948: Auf dem Friedhof der Märzgefallenen im Friedrichshain werden zwei Grabsteine für jüdische Barrikadenkämpfer errichtet (u.a. für Levin Weiß).
1949: Heinz Galinski wird Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
1953: Organisatorische Trennung in eine Berliner West- und Ostgemeinde. Die Jüdische Gemeinde in Ost-Berlin "... war sehr klein, unter 200 Mitglieder, völlig
überaltert. Wir haben uns Soegen gemacht. Der Letzte macht das Licht aus" meinte im Jahre 2015 rückblickend Hermann Simon, langjähriger Direktor der Stiftung Neue Synagoge (vgl. Interview in der
"Berliner Zeitung", 10. November 2015, S. 16).
1955: Eröffnung des Friedhofs Heerstraße
Die jüdische Gemeinde zu Berlin stiftet den Heinrich-Stahl-Preis, der an Personen oder Vereinigungen verliehen wird, die laut Stiftungsurkunde des Preises nach jüdisch-ethischer Bewertung zur Verwirklichung von Grundsätzen der Demokratie, Toleranz und Humanität beitragen.
1959: Einweihung des Jüdischen Gemeindehauses Fasanenstraße
1962: Wiedereröffnung der Jüdischen Volkshochschule Berlin
1964: Abriss der Ruine der im 2. Weltkrieg zerstörten Petrikirche in (Alt-) Cölln.
80er Jahre: In der ganzen DDR gibt es ca. 3000 gläubige Juden. In Ost-Berlin mit seinen 1,2 Mio. Einwohnern hat die jüdische Gemeinde etwa 200 Mitglieder, davon 150 im Rentenalter. Jedoch gibt es auch eine Jugend- und eine Kindergruppe sowie ein religiöses Leben. Es gab einen einzigen koscheren Fleischer in Ost-Berlin (in der Eberswalder Str. 20, vgl. Hilker-Siebenhaar, S. 373, a.a.O.), der schächtende Fleischer kam dazu aus Budapest angereist. Zuerst bekamen dann die Gemeindemitglieder das Fleisch, dann erst die Diplomaten und andere.
1985-1987: Wiedererrichtung des Ephraim-Palais unter Wiederverwendung der erhaltenen Fassadensteine in unmittelbarer Nähe des alten Standorts. Heute beherbergt das Palais eine Filiale der Berliner Stadtmuseums.
Juli 1986: Wiedereröffnung des restaurierten Friedhofs der ehemaligen Separatgemeinde „Adass Jisroel“ in Berlin Weißensee.
1988: In Zusammenhang mit dem Gedenken zum 50. Jahrestag der Pogromnacht wird die Stiftung „Neue Synagoge Berlin-Centrum Judaicum“ gegründet, um die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße wiederaufzubauen und ein Zentrum für die Pflege und Bewahrung jüdischer Kultur in Berlin zu schaffen.
29. Oktober 1990: Montage des letzten Segments der wiederhergestellten Hauptgruppe der neuen Synagoge, eine Richtkrone wird feierlich hochgezogen.
18. Dezember 1989: Die neue DDR-Regierung verfügt zum 50. Jahrestag der NS-Auflösung die Wiedereinsetzung der Israelitischen Synagogen-Gemeinde (Adass Jisroel) zu Berlin in ihre entzogenen Rechte.. Zu Purim 1990 (5750) wird im früheren Gemeindehaus eine neue Synagoge wiedereingeweiht, Torahrollen kommen aus Israel.
5. Juni 1991: Der „Magen David“, der Davids Stern schmückt wieder die Hauptgruppe der Neuen Synagoge.
Juli 1991: Im Gemeindehaus von Adass Jisroel wird das koschere Restaurant „Beth Café" eröffnet.
zwischen 1991 und 1998: Am Bahnhof Grunewald entsteht das eindrucksvolle, weitläufig dimensionierte Mahnmal „Gleis 17“, das an die Rolle der Reichsbahn während des Völkermordes erinnern soll. U.a. werden beiderseits des Gleises 17, von dem die meisten Deportationszüge abfuhren, gusseiserne Platten verlegt. Auf diesen Platten sind in zeitlicher Abfolge alle Fahrten von Berlin mit Anzahl der Deportierten und dem Zielort dokumentiert.
1991: Auf Beschluss der Innenministerkonferenz tritt eine Kontingentflüchtlingsregelung für Juden aus der zerfallenden UdSSR in Kraft; sowjetische Juden wird damit in Deutschland ein permanenter Aufenthaltsstatus, eine Arbeitserlaubnis sowie der Zugang zum deutschen Bildungs- und Sozialsystem ermöglicht (vgl. Freitag, Nr. 38/September 2016).
April
1992: In der Auguststraße entsteht ein Laden für koschere Lebensmittel und für jüdische Ritualobjekte
„Kolbo" (≙„Alles drin"). Die Wiederherstellung der historischen Synagoge von Adass Jisroel sowie die Restaurierung
der zerstörten Mikwe sind geplant. Seit der Einwanderung russischer Juden nach Berlin gibt es unter dem Dach der Jüdischen Gemeinde Grupperungen, "... die miteinander nur Russisch sprechen" (vgl.
"Berliner Zeitung", 10. November 2015, S. 16).
1992: Das Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien (MMZ) wird als Institut an der Universität Potsdam gegründet. Es ist ein interdisziplinär arbeitendes wissenschaftliches Forschungszentrum, das historische, philosophische, religions-, literatur- und sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung betreibt.
Schuljahr 1993/94: In dem restaurierten Schulgebäude in der Großen Hamburger Straße entsteht neben einer Realschule das erste jüdische Gymnasium Deutschlands. Eine Privatschule, die allen – auch Nicht-Juden - offen steht und vom Berliner Senat finanziell gefördert für alle bezahlbar.
1995: Staatsvertrag zwischen der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und dem Land Berlin
In der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße erinnert nun eine Gedenktafel an Wilhelm Krützfeld.
In der Grünanlage der Rosenstraße wird das Skulpturen–Ensemble „Block der Frauen“ der Berliner Bildhauerin Ingeborg Hunzinger (1915 – 2009) aufgestellt.
seit 1998: In der Rathausstraße erinnert eine Gedenktafel an Levin Weiß, einen der jüdischen Märzgefallenen der Revolution von 1848.
1999: Schändung des jüdischen Friedhofs Weißensee, 103 Grabsteine werden umgestürzt und teilweise zerstört.
Gründung des Rabbinerseminars Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, eines An-Instituts der dortigen Universität. Es handelt sich um die erste entsprechende Neugründung in Kontinentaleuropa nach der Shoa. Rektor des Kollegs ist seit Beginn Walter Homolka. Seit 2008 bildet es auch Kantoren aus.
19. April 1999: Der Zentralrat der Juden in Deutschland erwirbt das ehemalige Hochschulhaus in der Tucholskystraße 9 und eröffnet es als „Leo-Baeck-Haus“. Das Haus wird Sitz des Zentralrats.
2001: Eröffnung des Jüdischen Museum; Architekt: Daniel Libeskind
2003: Der Film „Rosenstraße“ der deutschen Regisseurin Margarethe von Trotta kommt in die Kinos. Der umstrittene Film basiert auf den Rosenstraße-Protesten von 1943 in Berlin.
2005: Einweihung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas
2007/2009: Ausgrabungskampagnen im ehemaligen Cöllner Stadtzentrum; aufgefunden werden u.a. Fundamente der Petrikirchen, der Lateinschule und des Cöllner Rathauses.
Die evangelische Kirchengemeinde St. Petri – St. Marien beschließt 2009 anstelle der Petrikirche etwas ganz neues zu errichten, ein „Bet- und Lehrhaus“ der drei „maßgeblichen monotheistischen Religionen“ (vgl. Dodt, a.a.O.), ein „Haus des Einen“ (eng. „House of One“). Der Verein „Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin“ beginnt in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Berlin (und dem Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam) sowie der muslimischen Dialoginitiative „Forum Dialog“ für etwas „… bisher noch nirgends Versuchtes. … Ein friedvolles Neben- und Miteinander unter einem Dach und an einem Tisch, und doch in der jeweils eigenen Denomination [1], im Festhalten und der (Glaubens-) Kraft der eigenen Traditionen und Besonderheiten“ (vgl. Dodt, a.a.O.).
27. Oktober 2008: Einweihung der Gedenkstätte „Stille Helden“ zum deutschen Widerstand gegen die Judenverfolgung 1933 – 45, im Vorderhaus der Rosenthaler Straße 39 (vgl. Karte östlich von Nr. 3)
30. November 2008: In Berlin wird am S- und U-Bahnhof Friedrichstraße eine durch Spenden finanzierte Skulptur eingeweiht, die an die Kindertransporte 1938/39 nach England erinnert. Zuvor waren bereits vergleichbare Denkmäler am Londoner Bahnhof Liverpool Street Station und am Wiener Westbahnhof aufgestellt worden. Es folgten im Mai 2009 ein Denkmal vor dem Hauptbahnhof Danzig und seit November 2011 ein Denkmal in Hoek van Holland. Alle diese Orte spielten bei den damaligen Kindertransporten eine bedeutende Rolle.
2009:Wiedereröffnung des Rabbinerseminars in Berlin (10115, Brunnenstraße 33) durch den Zentralrat der Juden in Deutschland. Rektor ist der in Frankfurt/Main geborene Rabbiner Dayan Chanoch Ehrentreu. Gegenwärtig (2014) studieren acht angehende Rabbiner am Seminar, das Studium dauert vier Jahre.
2010 bis 2012: Auf Teilen der Fläche des ehemaligen Großen Jüdenhofes erfolgen archäologische Untersuchungen, die allerlei Fundamente, Keramiken etc. aus dem 17./18. Jhdt. zutage förderten, aber keine jüdischen Bewohnern zuordenbare Objekte. Archäologen vermuten Synagogen. und Mikwe-Reste nördlich des Ausgrabungsgebietes.
2012: In dem Wettbewerb für das „Haus des Einen“ am Petriplatz setzt sich das Berliner Architektenbüro Kuehn Malvezzi durch: Geplant sind dort drei getrennte Sakralräume für Juden, Christen und Muslime sowie ein zentraler „Raum der Begegnung“, ein Kuppelaal in der Mitte des Bauwerks. Die Grundsteinlegung ist für 2018 geplant (vgl. Dodt, a.a.O.).
11. September 2014: Nach langem Streit wird der Platz vor dem Jüdischen Museum in der Lindenstraße als Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz eingeweiht.
24. Januar 2015: Der Sender „Phönix“ sendet um 20.15 Uhr den Film „Ein blinder Held – die Liebe des Otto Weidt“, ein Doku-Drama aus dem Jahre 2014 unter der Regie von Heike Brückner und Jochen von Grumbkow, mit u.a. Edgar Selge als Otto Weidt und mit Inge Deutschkron.
2015: Nach Angaben der Bundesregierung wurden im Jahre 2015 in Deutschland 1366 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund ermittelt, darunter 36 Gewalttaten. Allein in Berlin zählte man 405 antisemitische Vorfälle. Dabei dürfte die Dunkelziffer noch höher liegen. Wie Benjamin Steinitz (von der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus) ausführte: „Wir wissen, dass viele Juden und Jüdinnen ihre Erfahrungen nicht zur Anzeige bringen und deshalb nicht in der offiziellen Statistik auftauchen“ (Steinitz, zit. n. „Tagesspiegel“ 3. August 2016, S. 7).
Die Berliner Jüdische Gemeinde hat ca. 11 000 Mitglieder (vgl. "Berliner Zeitung", 10. November 2015, S. 16).
2016: Die jüdischen Gemeinden in Deutschland haben ca. 110 000 Mitglieder, darunter etwa 95 000 Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion (vgl. Freitag, Nr. 38/September 2016).
Juli 2016: In der Moabiter Ellen-Epstein-Straße wird auf Initiative der „Sie waren Nachbarn“ eine Gedenktafel aufgestellt, die an die Deportation von mehr als 30 000 Berliner Juden vom Güterbahnhof Moabit erinnert.
Juli/August 2016: Die neuaufgestellte Gedenktafel in Moabit wird mit schwarzer Farbe beschmiert. Wenige Tage später wird eine der Bronzefiguren, die auf dem Jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße an der Völkermord erinnern, mit einem „Hitlerbart“ bemalt (vgl. „Tagesspiegel“ 3. August 2016, S. 7).
September 2016: Der Verein „Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin“ wird in die „Stiftung ‚House of One‘“ überführt, der Träger des Projekts wird.
2017: Zu dem Reformationsjubiläum ist eine Bepflanzung des Geländes des geplanten „Haus des Einen“ am Petriplatz vorgesehen: der Grundriss mit den drei Gebetsräumen und dem zentralen Raum der Begegnung soll sichtbar gemacht werden (vgl. Dodt, a.a.O.).
Weiterführende Literatur:
Dieter Hoffmann-Axthelm: „Der Große Jüdenhof. Ein Berliner Ort und das Verhältnis von Juden und Christen
in der deutschen Stadt des Mittelalters“, Lukas Verlag, Berlin, 2005
Bertha Badt-Strauss: „Mendelssohn und die Berliner", in der „Vossischen Zeitung" (Berlin) vom 6. September
1929,. zit. n. http://www.diegeschichteberlins.de/geschichteberlins/persoenlichkeiten/
persoenlichkeitenhn/508-mendelssohn-in-berlin.html
Dietz Bering: „Isidor - Geschichte einer Hetzjagd - Bernhard Weiß, einem preußischen Juden zum Gedächtnis",
in: Zeit, Nr. 34 /1988
Berliner Künstlerprogamm der DAAD für das Heimatmuseum Berlin - Mitte (Hrsg.): "The Missing house",
Berlin 1992
Wolfgang Bethge: „1237 – 1987 – Berliner Geschichte im Überblick“, Verlag Gebr. Holzapfel, Berlin, 1987
Barbara Beuys: „Der Große Kurfürst – Der Mann der Preußen schuf”, Rowohlt Verlag, Reinbek bei
Hamburg, 1979
Claudia Brunner / Uwe von Seltmann: „Schweigen die Täter, reden die Enkel“,Fischer, Frankfurt am Main,
2006, 2.Aufl.
Inge Deutschkron: "Ich trug den gelben Stern", Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1978
Richard Dietrich (Hrsg.): „Berlin – Neun Kapitel seiner Geschichte“, Walter de Gruyter Verlag, Berlin, 1960
Marina Dodt: „Ein Haus – drei Religionen – In Berlin entsteht als ‚House of One‘ das interreligiöse Bet- und
Lehrhaus Petriplatz“; in: „Tag des Herrn“, Nr. 46, 13. November 2016, S. 10
Ingeborg Drewitz: „Märkische Sagen - Berlin und die Mark Brandenburg“, Diederichs Verlag, München,
2 1992
Annegret Ehmann/Rachel Livné-Freudenthal/Monika Richarz/Julius H. Schoeps/Raymond Wolff: „Juden
in: „Berlin 1671 – 1945. Ein Lesebuch“, Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin 1988
Bernt Engelmann: „Trotz alledem – Deutsche Radikale 1777 – 1977“, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1979
Shmuel Feiner: „Moses Mendelssohn – Ein jüdischer Denker in der Zeit der Aufklärung“; aus dem Hebräischen
von Inge Yassur, mit einem Vorwort von Dan Diner, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2009
Hermann–Josef Fohsel: „Berlin, du bunter Stein, du Biest – Biografische Erkundungen“, Koehler & Amelang,
München , Berlin, 2002
Friedrich Gedike/Johann Erich Biester (Hrsg.): „Berlinische Monatsschrift 1783 – 1796 – Auswahl“, Reclam,
Leipzig 1986
Manfred Geier: „Aufklärung – Das europäische Projekt“, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische
Bildung“, Bonn 2012
Ludwig Geiger: „Geschichte der Juden in Berlin", 2 Bde (unvollendet)., Berlin 1871
Elke Geisel: „Im Scheunenviertel - Bilder, Texte und Dokumente", Severin und Siedler, Berlin 1981
Christian Fürchtegott Gellert: „Leben der Schwedischen Gräfinn von G**“, in: C. F. Gellerts sämmtliche
Schriften“, Neue rechtmäßige Ausgabe, Vierter Teil, Weidmann’sche Buchhandlung und
Hahn’sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig, 1893, S. 189 ff.
Ruth Glatzer (Hrsg.): „Berliner Leben 1648 – 1806“, Rütten & Loening Verlag, Berlin, 1956
Alexander Granach: "Da geht ein Mensch - Roman eines Lebens", Weismann Verlag, München 1984 3
Ernst Grau: „Berliner Sagen und Geschichten“, Altberliner Verlag Lucie Groszer, Berlin 1954
Leonard Gross: Versteckt – Wie Juden im Berlin der Nazi-Zeit überlebten“, Deutsch von Cornelia Holfelder –
v. d. Tann, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1983
Günter Hartung: „Juden und deutsche Literatur“, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, 2006
Heimatgeschichtliches Kabinett Berlin - Mitte (Hrsg.): "Zur Geschichte der Sophienstraße", Berlin 1988
Carolin Hilker-Siebenhaar (Red.): „Wegweiser durch das jüdische Berlin - Geschichte und Gegenwart",
Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin 1987
Rudolf Hirsch / Rosemarie Schuder: "Der Gelbe Fleck - Wurzeln und Wirkungen des Judenhasses in der
Deutschen Geschichte", Rütten & Loenìng, Berlin 1989
Der Toleranzgedanke in der deutschen Literatur zur Zeit Moses Mendelssohns“, Severus Verlag,
Hamburg 2012 ; Nachdruck der Ausgabe von 1914
Gernot Jochheim: „Frauenprotest in der Rosenstraße - Gebt uns unsere Männer wieder“, Edition Hentrich,
Berlin, 1993
Thomas Kaufmann: „Luthers Juden“, Reclam, Stuttgart 2014
Heinz Knobloch: "Herr Moses in Berlin - Auf den Spuren eines Menschenfreundes", Buchverlag Der
Morgen,1985 4
Heinz Knobloch: "Der beherzte Reviervorsteher“, in: Wochenpost, Nr. 26 /1988
Heinz Knobloch: „Der arme Epstein - Wie Horst Wessel zu Tode kam“, Links Verlag, Berlin 1993
Heinz Knobloch: Der beherzte Reviervorsteher/ Ungewöhnliche Zivilcourage am Hackeschen Markt,
Morgenbuchverlag, Berlin, 1993
Karl Kupisch: „Adolf Stoecker – Hofprediger und Volkstribun“, Berlinische Reminiszenzen 29, Haude &
Spenersche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1970
Ariane Kwasigroch (red.): „Blindes Vertrauen – Ausstellung in der ehemaligen Blindenwerkstätte Otto Weidt“,
Berlin, 1998
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin: „Gedenken und Lernen an historischen Orten – Ein
Wegweiser zu Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Berlin“, Berlin 1995
M. Landau: „Gellert und die Juden“, in: „Im deutschen Reich – Zeitschrift des Centralvereins Deutscher Staats-
bürger Jüdischen Glauben“, Heft 4/1895, S. 170-172
Gotthold Ephraim Lessing: „Sämtliche Werke“, Bd. 6, Göschen’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1890
John Locke: „Ein Brief über Toleranz“, Philosophische Bibliothek, Meiner Verlag, Hamburg, 1996
Karl Marx / Friedrich Engels: „Werke“, Bd. 32, Dietz Verlag, Berlin, 1973
Franz Mehring: „Die Lessing-Legende – Zur Geschichte und Kritik des Preußischen Despotismus und der
Klassischen Literatur“, Dietz Verlag, Berlin, 1953
Beate Meyer: „Geschichte im Film: Judenverfolgung, Mischehen und der Protest in der Rosenstraße 1943“; in:
„Zeitschrift für Geschichtsforschung“, 52 (2004), S. 23–36
Christian Meyer/Thomas Friedrich: „Zwischen Akzeptanz, Toleranz, Verfolgung und Völkermord –
Stadtrundgang auf verwehten Spuren im Zentrum Berlins“, in: Michael Drechsler (Hrsg.): „Preußens
Toleranz – Die Integration von Minderheiten in Geschichte und Gegenwart“; Museumspädagogischer
Dienst, Berlin, 2002, S. 159 - 189
Museum für Vor- und Frühgeschichte (Hrsg.): "Bürger - Bauer - Edelmann - Berlin im Mittelalter“ ,Nicolai-
sche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1987
Andreas Nachama / Gereon Sievernichs (Hrsg.): „Katalog zur Ausstellung Jüdische Lebenswelten“, Suhr-
kamp Verlag / Jüdischer Verlag, Berlin 1991
Pädagogisches Zentrum Berlin (Hrsg.): "Steinerne Zeugen - Stätten der Judenverfolgung in Berlin", Verlag
Albert Hentrich, Berlin 1982
Pädagogisches Zentrum Berlin (Hrsg.): "Stätten des Judentums - Beispiel Berlin Mitte; Material für eine
Stadtwanderung", Internes Arbeitspapier, Berlin 1992
Olaf Preuß: "Der liebe Gott wird ein Auge zudrücken - Ostdeutsche Juden suchen nach ihrer Geschichte und
ihrer Identität", in: Wochenpost Nr. 3 / 1993
Joseph Roth: "Juden auf Wanderschaft", in: ders.: "Orte - Ausgewählte Texte“, Reclam Verlag, Leipzig 1990
Anselm Salzer / Eduard von Turk: „Illustrierte Geschichte der Deutschen Literatur“, 6 Bde., Zweiburgen
Verlag, Naumann & Gödel, Köln, o.J.
Regina Scheer: „Bürstenfabrik Otto Weidt. Ein Bericht“, in: Temperamente, Berlin (Ost) 1984, S. 62-75.
Manfred Schlenke (Hrsg.): „Preußen – Beiträge zu einer politischen Kultur“, Bd. 2 des Katalogs zur Ausstellung „Preußen – Versuch einer Bilanz“, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1981
Heinrich Schnee (Hrsg.): "Quellen zur Geschichte der Hoffaktoren in Deutschland"; Band 5 in: ders. "Die Hof- finanz und der moderne Staat", Duncker & Humblot, Berlin 1965
Peter Schneider: „‘Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen...‘. Wie ein jüdischer Musiker die Nazi-Jahre über-
lebte“ Rowohlt, Berlin, 2001
Dieter H. Schubert: „Was war wo ? Historische Adressen in Berlin“, Elefanten – Press, Berlin, 1993
Uwe Schultz: „Immanuel Kant in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten“, rowohlts monographien Nr. 101,
Reinbek bei Hamburg, 1965
Stadtteilführer: „Scheunenviertel Berlin - Sieben Wandertouren“, edition Scheunenviertel, Verlag Neues
Leben, Berlin 1993
Gerhard Steiner: „Drei preußische Könige und ein Jude – Erkundungen über Benjamin Veitel Ephraim und
seine Welt“, Edition Hentrich, Berlin 1994
Selma Stern: „Der Preußische Staat und die Juden", Berlin 1925
Jacob Toury: „Die politischen Orientierungen der Juden in Deutschland – von Jena bis Weimar“,
Wissenschaftliche Abhandlung des Leo Baeck Instituts Nr. 15, Mohr Verlag, Tübingen 1966
Verein Stiftung Scheunenviertel (Hrsg.):“Das Scheunenviertel - Spuren eines verlorenen Ortes“, Haude &
Spener. Berlin 1994
Wolfgang Wippermann: „Geschichte der deutschen Juden - Darstellung und Dokumente“, Berliner Institut für
Lehrerfort- und - weiterbildung und Schulentwicklung, 1994
Thilo Wydra: „Rosenstraße – Die Geschichte. Die Hintergründe. Die Regisseurin“, Nicolai, Berlin 2003
[1] Die Politik König Friedrich II. gegenüber den Juden kann keineswegs als tolerant bezeichnet werden. So hob er z.B. am 12. Januar 1761 die vom preußischen Generaldirektorium (der obersten Verwaltungsbehörde) erteilten Aufenthaltsgenehmigungen für neue jüdische Einwanderer wieder auf und ließ sie ausweisen: sie waren nicht wohlhabend genug. Generell ließ er - realpolitisch - die armen „Betteljuden" vertreiben und privilegierte reiche Juden, nutzte deren Finanzkraft und internationale Verbindungen.
[2] Ephraim bedeutet im Hebräischen „der Fruchtbare".
[3] Aus einem zeitgenössischen Bericht, 1779 ( zit. n. Annegret Ehmann et al., S. 52, a.a.O.).
[4]Nach einer anderen Nummerierung war es das Haus Spandauer Straße Nr. 33. Das Haus befand sich ca. an der heutigen Kreuzung Karl-Liebknechts-Straße/ Spandauer Straße. Gotthold Ephraim Lessing wohnte zuvor von 1751 bis 1753 in demselben Haus.
[5] Die älteste Tochter Moses Mendelsohns, Brendel, nannte sich später Dorothea, trat zum Christentum über und heiratete den Philosophen Friedrich Schlegel.
[6] "Hofjuden" oder "Hoffaktoren" waren oft gleichzeitig Hoflieferanten, Hofjuweliere, Heeres- und Kriegslieferanten, Steuereinnehmer, diplomatische und politische Agenten und Hof- und Staatsbankiers in verschiedenen spätmittelalterlichen und absolutistischen Staaten. Die Hoffaktoren hatten einen bedeutenden Anteil an der Wiederansiedlung jüdischer Familien in der Mark Brandenburg und für die Verleihung staatsbürgerlicher Rechte für die jüdische Bevölkerung.
[7] Alle Juden, auch durchreisende Händler, Handwerker etc. mussten den "Leibzoll" an den Kurfürsten entrichten.
[8] Solchen akzeptierenden Schritten Juden gegenüber standen jedoch auch immer wieder diskriminierende Maßnahmen der preußischen Regierung gegenüber, so z.B. 1711: Der preußische König Friedrich I. lässt - von zwei jüdischen Renegaten veranlasst - die damals berühmte judenfeindliche Schrift von Johann Andreä Eisenmenger „Entdecktes Judentum" in der Mark neu auflegen.
[9] Heinz Knobloch hatte darauf hingewiesen: „Misstraut den Grünanlagen“ – hier befindet sie sich am Ort der zerstörten Synagoge.
[10] Krützfeld wurde 1880 in Seedorf im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein geboren. Das Bundesland Schleswig-Holstein würdigte Wilhelm Krützfeld am 9. November 1993 durch die Umbenennung der Landespolizeischule Malente in „Landespolizeischule Wilhelm Krützfeld“.
[11] „An der Spandauer Brücke“: Tatsächlich führte hier einst vom Spandauer Tor, zwischen den Bastionen XI und XII, eine Brücke über den Königsgraben; einem Teil der Berliner Festungsanlagen. Der Königsgraben mündete nahe der Westspitze der heutigen Museumsinsel in die Spree. Vor dem Spandauer Tor befand sich ein Ravelin, ein Außenwerk zum Schutz der Bastionen. Die Form des Ravelins ist noch heute noch durch den Platz vor dem Bahnhof Hackescher Markt abgebildet wird. Ab 1735 wurde der Festungsgraben, da er militärisch wertlos geworden war, schrittweise bis zum Ende des 19. Jhdts. zugeschüttet. Teilweise wurde auf dem Gebiet des Grabens später die Stadtbahn errichtet.
Die „Spandauer Brücke“ bildete 1938 die Grenze des Polizeireviers 16. Jenseits befand sich einst die Spandauer Vorstadt.
[12] Karl Friedrich Zelter (1758 - 1832) gründete die erste Berliner Liedertafel, war als Nachfolger Faschs Direktor der Berliner Singakademie und einer der Lehrer von Felix Mendelssohn - Bartholdy. Zelter war mit Goethe befreundet, eine Reihe von Goethe-Gedichten wurden von ihm vertont. Goethe schätzte diese Vertonungen sehr hoch, weit höher als die von Franz Schubert.
[13] Christoph Gottlieb Nicolai, der Vater Friedrich Nicolais, gründete 1713 die Nicolaische Verlagsbuchhandlung, einen der ältesten bis heute existierenden Buchverlage Deutschlands. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war das Nicolaihaus in der Brüderstraße 13 die Geschäfts-adresse der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung. Seinen heutigen Sitz hat der Verlag in Berlin-Mitte, Neue Grünstraße 17. Auch die Nicolaische Buchhandlung in der Friedenauer Rheinstraße 65 führt ihren Ursprung auf die Gründung zurück.
[14]Moses Wessely (1737 –1792), Großkaufmann, Vorkämpfer für religiöse Toleranz und wichtiger Sprecher der Hamburger Aufklärung. U.a. wegen seiner philosophischen Haltung und laxen Beachtung der Speisegesetze wurde auch er in der Hamburger jüdischen Gemeinde angefeindet. Carl Bernhard Wessely, ein Neffe von Moses, war der erste jüdische Komponist, dessen Werk in Hamburg öffentlich aufgeführt wurde, mit maßgeblicher Unterstützung von Carl Philipp Emanuel Bach.
[15] Mendelssohn hatte dem Marquis d’Argens gegenüber bestätigt, dass die Judenältesten gezwungen seien, ihn polizeilich zu vertreiben, falls ihn die Witwe Bernhard entließe und ihn „… nicht einer von den Trödeljuden in der Reezengasse (die spätere Parochialstraße, C.M.) für seinen Diener erklären“ würde (Mendelssohn, zit. n. Mehring, S. 295, a.a.O.). D’Argens äußerte daraufhin in einem Brief an den König: « Un philosophe mauvais catholique supplie un philosophe mauvais protestant de donner le privilège à un philosophe mauvais juif. Il y a dans tout ceci trop de philosophie pour que la raison ne soit pas du côté de la demande".
[16]Einige der Zwangskäufer konnten jedoch mit dem Porzellan gute Geschäfte machen, denn später erhielten die frühen KPM – Stücke einen großen Seltenheitswert und Sammler zahlten für Sie hohe Preise.
[17] Bernhard Weiß (1880-1951) stammte aus einer wohlhabenden liberalen jüdischen Familie Berlins. Sein Vater war Vorsteher der liberalen jüdischen Gemeinde. Er studierte Jura, musste aber – um eine Anstellung zu finden – nach Bayern gehen. Dort wurde er Amtsrichter und Reserveoffizier. Im ersten Weltkrieg wurde er wegen besonderer Tapferkeit mit dem EK I ausgezeichnet.
[18] In der Pogromnacht 1938 wurde auch die Synagoge in der Rykestraße in Brand gesteckt, doch der Polizeikommandant des zuständigen Polizeireviers hat rasch den Befehl zum Löschen gegeben. Bewahrt wurde die Synagoge durch eine städtebauliche Besonderheit. Das Gebäude befindet sich in einem Hinterhof, so dass es die Brandstifter wegen der angrenzenden Wohnhäuser unterließen, Feuer zu legen. Die Nachbargrundstücke sollten durch das Feuer nicht gefährdet werden. Allerdings wurden die Thorarollen geschändet, Rabbiner und Gemeindemitglieder wurden in das KZ Sachsenhausen deportiert und der Synagogeninnenraum demoliert.
Noch bis zum Mai 1940 konnten in der Rykestraße Gottesdienste abgehalten werden, danach wurde das Gebäude als Lager für die Wehrmacht als Depot und Pferdestall missbraucht.
Die Synagoge in der Rykestraße ist wohl die größte erhaltene Synagoge in Deutschland.
Desgleichen wurde die Synagoge in der Pestalozzistraße aufgrund ihrer Hoflage im November 1938 schwer demoliert und geschändet, aber nicht in Brand gesteckt. Sie wurde nach dem 2. Weltkrieg restauriert und schon im September 1947 wieder geweiht.
Und auch die Synagoge der Gemeinde Addas Jisroel (Tucholsky-Straße 40) mit 800 Plätzen überlebte den Pogrom 1938 im Schatten des Hinterhofes. Sie stand bis 1967 und wurde dann, wegen (angeblicher) Baufälligkeit abgetragen.
[19] 1945 flüchtete Alois Brunner flüchtete von Linz nach München, wo er unter falschem Namen für die US-Besatzungsarmee als Lkw-Fahrer tätig war. Von 1947 bis 1954 lebte und arbeitete Brunner unter falschem Namen in der Zeche Carl Funke in Essen, wo er auch polizeilich gemeldet war. Bei Brunners Flucht nach Syrien unter falschem Namen soll er prominente Fluchthelfer gehabt haben, so Reinhard Gehlen, den vormaligen Leiter der „Abteilung Fremde Heere Ost“ der Wehrmacht und späteren Chef des BND, und u.U. Rudolf Vogel (1906-1991), Autor antisemitischer Schriften, Mitglied der NS-Propagandastaffel in Saloniki und bis 1964 MdB der CDU. Später verschwanden eine ganze Reihe von vermutlich diesbezüglichen Akten.
Alois Brunner arbeitete in Syrien zeitweise als Vertreter für die Dortmunder Actien-Brauerei DAB, dann auch für syrische Behörden. Mehrere Auslieferungsanträge wurden abgelehnt. Mehrfach wurde Brunner in Syrien interviewt, er rühmte sich dabei seiner mörderischen Tätigkeit bis 1945.
Nach Angaben des Simon Wiesenthal Centers soll Brunner im Jahr 2009 oder 2010 in Damaskus gestorben sein

Pranger an der mittelalterlichen „Gerichtslaube“ (Abbn. aus „Tagesspiegel“, 3. Januar 2015, S. 27); die Zeichnung des deutschen Malers Ludwig Burger (1825-1884) zeigt einen Mann, der nach seinem Prozess um 1380 am Pranger der Gerichtslaube öffentlich ausgepeitscht wird.

Ecke des Alten Rathauses mit Uhrenturm und Gerichtslaube, in barockem Bauzustand um 1840; wegen (angeblicher) Behinderung des Verkehrs wurden Turm und Laube später abgerissen.

Herbert-Baum-DDR-Briefmarke von 1961

Moses Mendelssohn, (1771, Porträt von Anton Graff, heute im Kunstbesitz der Universität Leipzig
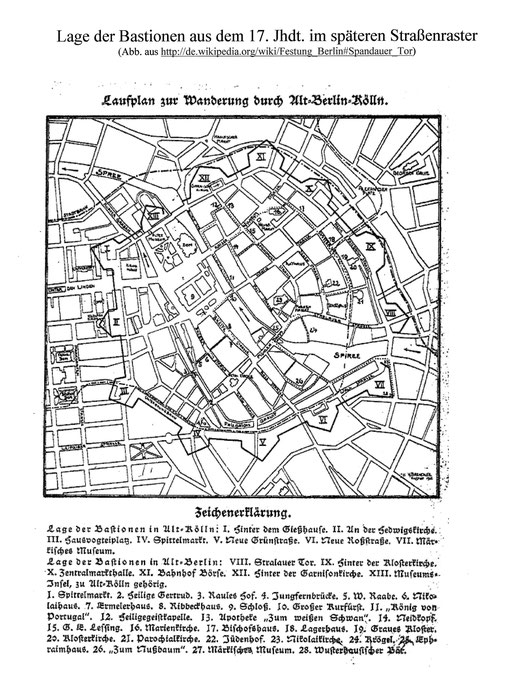

Photo der NS-Propaganda-Ausstellung "Das Sowjetparadies" im Lustgarten 1942

Baustelle der Neuen Synagoge - Gedenktafel

DDR- Briefmarke von 1990

Fotomontage „Grenadierstraße“ aus dem Jahre 1930, des jüdisch-deutschen Photographen Abraham Pisarek (1901 – 1983, in West-Berlin); Pisarek war mit einer nichtjüdischen Frau verheiratet und überlebte durch die Frauenproteste in der Rosenstraße.

Detail des Mahnmals Gleis 17 am Bahnhof Grunewald

Fort 9 in Kaunas – Gedenktafel beim Fort 9 in Kaunas
(Photos von Werner Beyschwang, Mai 2016)
Nach den Planungen der Gesellschaft Historisches Berlin sollte der Neue Markt so in Zukunft aussehen: In der Mitte das Luther-Denkmal, im Hintergrind das Rote Rathaus und links die Marienkirche (Abb. aus "Berliner Zeitung", 17. Februar 2015, S. 16).
Zum 75. Gedenken an die Protestaktion in der Rosenstraße am 27. Februar 2018 wurden an dem dortigen Denkmal Lichter dieser Art niedergestellt (Photo: Christian Meyer, 27. März 2018).
 meyer - schodder schodder + meyer
meyer - schodder schodder + meyer